Uli Gottfried - Meine Geschichte als Betroffener von Kopfgelenksinstabilität und Kopfgelenkssymptomen

Hinweis: In diesem Artikel schildere ich, Uli Gottfried, meine persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen zum Thema Kopfgelenksinstabilität (CCI). Ich bin kein Arzt, und meine Ausführungen ersetzen keine medizinische Beratung oder Behandlung. Für individuelle Diagnosen und Therapien wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Ärztin oder einen Arzt.
Uli Gottfried hat über viele Jahre hinweg selbst unter Kopfgelenksinstabilität (CCI) gelitten – einer komplexen und bislang wenig anerkannten Erkrankung der oberen Halswirbelsäule. Seine persönliche Erfahrung, kombiniert mit intensivem Austausch in der Selbsthilfe und fundierter Recherche, hat ihn dazu gebracht, die Zusammenhänge zwischen Symptomen, Diagnostik und ganzheitlichen Therapieansätzen besser zu verstehen.
Die Kopfgelenksinstabilität kann eine Vielzahl von Beschwerden auslösen – darunter Schwindel, Sehstörungen, Herzrasen, Übelkeit, Angstzustände und neurologische Ausfälle. In Deutschland wird sie oft nicht als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt, was viele Betroffene in eine lange Suche nach Antworten und wirksamer Hilfe zwingt.
In diesem Artikel beschreibt Uli Gottfried seinen Weg durch die Erkrankung, teilt Erkenntnisse aus der Selbsthilfegruppe und stellt ganzheitliche Ansätze vor – darunter Prolotherapie, CMD-Diagnostik, Mikronährstofftherapie, Injury Recall und die Arbeit mit seiner Frau, Dr. med. Doris Gottfried, die ihn medizinisch begleitet hat. Ziel ist es, anderen Betroffenen Orientierung zu geben und das Bewusstsein für die Kopfgelenksinstabilität zu stärken.
Uli Gottfried – Meine wichtigsten Symptome bei Kopfgelenksinstabilität
Obwohl ich in meinen Videos bereits ausführlich über meinen Krankheitsverlauf spreche, möchte ich hier die wichtigsten Symptome zusammenfassen, die mich über viele Jahre begleitet haben.
Typische Symptome, die bei mir auftraten:
Schwindelattacken
Anfallsartig, bis zu 6 Stunden Dauer. Häufige Krankenhausaufenthalte in der Notaufnahme. Diagnose: Morbus Menière.
Dranginkontinenz & häufiges Wasserlassen
Die Diagnose lautete damals psychosomatisch.
Sehstörungen
Ich konnte wochenlang nicht aus dem Haus gehen, da ich Bewegungen wie fahrende Autos oder Waldspaziergänge visuell nicht verarbeiten konnte.
Angststörungen
Alpträume und nächtliche Unruhezustände. Es fühlte sich an, als hätte ich zwei Kannen Kaffee getrunken.
Nächtliche Schweißausbrüche
Besonders intensiv in den frühen Morgenstunden.
Übelkeit & Erbrechen
Direkt nach dem Aufstehen, oft bis zu 45 Minuten anhaltend.
Herzfrequenzprobleme & Bluthochdruck
Mein Ruhepuls lag konstant bei etwa 120 Schlägen pro Minute.
Uli Gottfried – Mein Krankheitsverlauf bei Kopfgelenksinstabilität
Frühe Anzeichen: Hörsturz und HWS-Verspannung (Alter 38)
Meine gesundheitliche Lage war über Jahre hinweg kritisch. Die ersten Symptome zeigten sich mit einem Hörsturz im Alter von 38 Jahren. Bereits damals war meine Halswirbelsäule stark verspannt, was auch mein Osteopath deutlich spürte. Die Erholung dauerte rund zwei Jahre. Ich reagierte extrem empfindlich auf Geräusche und konnte ohne Gehörschutz weder duschen noch Autofahren. Zusätzlich litt ich unter starkem Ohrendruck auf der linken Seite.
Schwindelattacken und Fehldiagnosen (Alter 42)
Mit 42 Jahren begannen plötzlich Schwindelattacken, die mich erneut stark einschränkten. Ich suchte drei verschiedene Schwindelambulanzen auf, die unterschiedliche Diagnosen stellten:
- Zweimal Morbus Menière
- Einmal Vestibularisparoxysmie – eine Blutader berührte den Gleichgewichtsnerv
Obwohl tatsächlich etwas im Ohr geschah, vermutete ich die Ursache im Nackenbereich. Ich wusste jedoch nicht, welcher Arzt mir helfen konnte. Nach etwa einem Jahr ließen die Attacken nach, aber ich blieb geschwächt und hatte anhaltende Nackenschmerzen.
Zusammenbruch nach CMD-Behandlung (Alter 45)
Mit 45 Jahren verschlechterte sich mein Zustand dramatisch nach einer falschen CMD-Behandlung. Die Schwindelattacken kehrten zurück, begleitet von:
- Sehstörungen
- Unruhezuständen
- Schweißausbrüchen
- Herzfrequenzproblemen
- Atemnot
Ich war mehrere Monate bettlägerig und konnte nur etwa 30 Minuten täglich aufstehen. Es begann ein neuer Arztmarathon, bei dem mir erneut psychosomatische Diagnosen gestellt wurden. Auch die Einnahme von Psychopharmaka brachte keine Besserung – im Gegenteil, sie verursachten starke Nebenwirkungen.
Schwindelattacken und Angstzustände bei Kopfgelenksinstabilität: Meine schlimmsten Erfahrungen
Kroatien – Der Moment am Meer
Es war einer dieser Tage, die eigentlich voller Leichtigkeit sein sollten. Mein Sohn war noch ein Baby, wir waren als Familie am Meer in Kroatien. Doch plötzlich überrollte mich eine Schwindelattacke, so heftig, dass ich meine Frau bat, mich allein am Strand zurückzulassen. Sie kümmerte sich um unseren Sohn – und ich lag zwei Stunden lang mit geschlossenen Augen im Sand. Ich wusste nicht, ob ich je wieder aufstehen würde. Die Sonne brannte, das Meer rauschte – und in mir war nur Leere und Angst.
Vor der Kantine – Der Notarztwagen
Ein paar Wochen später, bei der Arbeit, stand ich vor der Kantine. Und wieder kam der Schwindel. Diesmal so stark, dass der Notarztwagen gerufen wurde. In der Notaufnahme konnte ich zehn Stunden lang die Augen nicht öffnen. Niemand wusste, was los war. Und dann wurde ich einfach nach Hause geschickt. Ohne Diagnose. Ohne Hilfe. Ich begann, mich aus Angst vor weiteren Attacken zu isolieren. Die Welt draußen wurde bedrohlich.
Der Schrank – Die CMD-Schiene
Ein weiterer Tiefpunkt kam beim Zusammenschrauben eines Möbelstücks. Ich hatte eine CMD-Schiene bekommen, die nicht richtig angepasst war. Plötzlich verspannte sich mein ganzer Körper. Die Attacke war so stark, dass sich meine Augen verschoben. Ich konnte kaum noch aus dem Haus gehen. Alles, was sich bewegte – Autos, Menschen, Bäume im Wind – löste Panik aus. Eine Winkelfehlsichtigkeitsbrille brachte etwas Linderung, aber die Angst blieb.
Vagusirritation – Der Weg auf allen Vieren
Die Vagusirritationen wurden so stark, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Mein Sohn war klein, meine Frau brauchte mich – und ich wollte da sein. Mit letzter Kraft kroch ich auf allen Vieren ins Bad, schleppte mich unter die kalte Dusche. Ich hoffte, dass irgendetwas hilft. Aber es half nichts. Ich war am Boden – körperlich, seelisch, existenziell.
Wenn die Notaufnahme keine Hilfe ist
Ich höre solche Geschichten immer wieder. Kürzlich wurde ein Freund aus meiner Selbsthilfegruppe mit dem Hubschrauber von der Autobahn ausgeflogen. Kurz zuvor war er bei einer Chirotherapeutin, die ihm – nach zuvor guter Behandlung – den zweiten Halswirbel entblockiert hatte. Diese „Befreiung“ blockierte die restlichen Wirbel so stark, dass sein Nervensystem kollabierte. In der Notaufnahme glaubte man ihm nicht.
Ich sehe es immer wieder: Wir können mit unseren Symptomen – so stark und akut sie auch sind – nicht einfach in die Notaufnahme fahren. Man glaubt uns nicht. Und selbst wenn man uns glauben würde, gäbe es dort keine Möglichkeit zu helfen. Was es bräuchte, wäre ein erfahrener Therapeut, der die Wirbel sanft und gezielt in die richtige Position bringt, um die Vagusirritation zu lösen. Doch solche Hilfe ist selten.
Kopfgelenksinstabilität: Uli Gottfried über fehlende Anerkennung und finanzielle Folgen
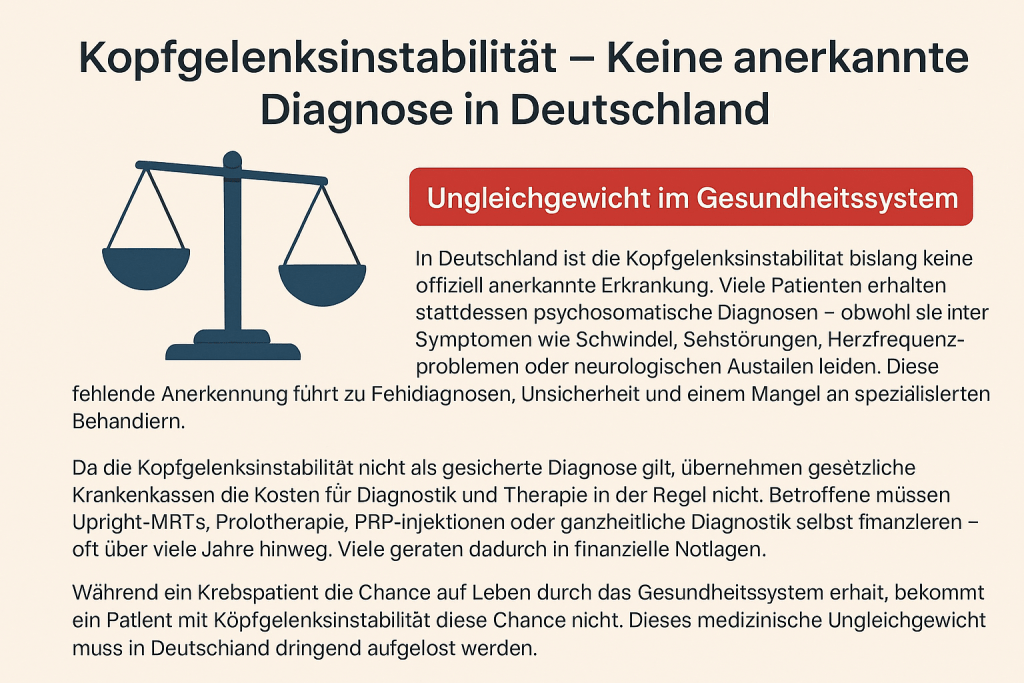
Kopfgelenksinstabilität – Keine anerkannte Diagnose in Deutschland
In Deutschland ist die Kopfgelenksinstabilität bislang keine offiziell anerkannte Erkrankung. Viele Patienten erhalten stattdessen psychosomatische Diagnosen – obwohl sie unter Symptomen wie Schwindel, Sehstörungen, Herzfrequenzproblemen oder neurologischen Ausfällen leiden. Diese fehlende Anerkennung führt zu Fehldiagnosen, Unsicherheit und einem Mangel an spezialisierten Behandlern.
Ungleichgewicht im Gesundheitssystem – Patienten bleiben auf Kosten sitzen
Da die Kopfgelenksinstabilität nicht als gesicherte Diagnose gilt, übernehmen gesetzliche Krankenkassen die Kosten für Diagnostik und Therapie in der Regel nicht. Betroffene müssen Upright-MRTs, Prolotherapie, PRP-Injektionen oder ganzheitliche Diagnostik selbst finanzieren – oft über viele Jahre hinweg. Viele geraten dadurch in finanzielle Notlagen.
Während ein Krebspatient die Chance auf Leben durch das Gesundheitssystem erhält, bekommt ein Patient mit Kopfgelenksinstabilität diese Chance nicht. Dieses medizinische Ungleichgewicht muss in Deutschland dringend aufgelöst werden.
USA: Anerkennung und moderne Therapien bei kraniozervikaler Instabilität
In den USA wird die sogenannte kraniozervikale Instabilität (CCI) bei Erkrankungen wie dem Ehlers-Danlos-Syndrom medizinisch anerkannt. Dort existieren spezialisierte Kliniken, moderne Diagnostikverfahren und regenerative Therapien.
Ein führender Experte ist Dr. Chris Centeno, Gründer der Regenexx-Klinik in Colorado. Er entwickelte das PICL-Verfahren, bei dem Stammzellen direkt in die geschädigten vorderen Bänder der oberen Halswirbelsäule injiziert werden – durch den Mund, um die vorderen Ligamente zu erreichen.
Klinische Erfahrung statt Studien – über 500 dokumentierte PICL-Behandlungen
Laut Klinikangaben wurden bereits über 500 PICL-Behandlungen durchgeführt. Zahlreiche Fallberichte dokumentieren deutliche Verbesserungen bei Patienten mit CCI. Auch wenn bislang keine groß angelegte, peer-reviewed Studie mit klaren Teilnehmerzahlen veröffentlicht wurde, zeigt die klinische Erfahrung: Kopfgelenksinstabilität ist real, komplex und behandelbar – wenn man sie erkennt und ganzheitlich angeht.
Dr. Centeno teilt seine Erkenntnisse in Blogs, Videos und dem Buch CCI 101: Understanding Craniocervical Instability and the Road to Recovery – ein umfassender Leitfaden für Betroffene und Therapeuten.
Mein Engagement für Anerkennung und Aufklärung
Ich setze mich mit meiner CCI-Selbsthilfegruppe, meinem YouTube-Kanal und dieser Webseite dafür ein, dass Kopfgelenksinstabilität auch im deutschsprachigen Raum ernst genommen wird. Patienten verdienen eine fundierte Diagnostik, eine ganzheitliche Therapie – und die Chance auf Heilung.
Kopfgelenksinstabilität: Mein Weg durch Dunkelheit, Hoffnung und ganzheitliche Heilung
Diese dunklen Zeiten haben mich verändert. Es gab einen Moment, in dem ich meiner Frau sagte: „Du musst jetzt alleine zurechtkommen.“ Ich hatte keine Kraft mehr. Keine Hoffnung. Ich war überzeugt, dass mein Weg zu Ende ist.
Doch was soll ich sagen? Es ging weiter.
Nicht plötzlich. Nicht einfach. Aber Schritt für Schritt. Ich habe eine lange Reise hinter mir – durch viele Stationen, mit vielen guten Ärzten, und mit einem enormen persönlichen Einsatz. Gleich zu Beginn erhielt ich zwölf PRP-Injektionen – ohne Erfolg. Eine zweijährige Borreliose-Behandlung brachte keine Stabilität, aber sie war eine wichtige Voraussetzung für spätere Heilungsschritte.
Ich ließ mir einen wurzelbehandelten Zahn entfernen, der Giftstoffe freisetzte. Ich entdeckte Störfelder – am Bauchnabel, im Bereich der Rachen- und Gaumentonsillen. Besonders eindrücklich war eine regenerative Kryotherapie bei einem russischen Arzt im Ruhrgebiet, bei der meine Rachentonsillen mit -200 Grad kaltem Stickstoff behandelt wurden. ch korrigierte meine Haltung durch eine gezielte HWS-Kurvenkorrektur – im Rahmen einer umfassenden CMD-Schienentherapie, bei der ich mir zum Abschluss 14 Zähne dauerhaft erhöhen ließ, was in etwa so viel kostete wie ein Kleinwagen.
Ich durchlief mehrere Injury Recall-Behandlungen an verschiedenen Körperstellen. Ich leitete Schwermetalle aus. Ich arbeitete intensiv an meinen Glaubenssätzen. Ich machte Faszienarbeit – immer wieder, bis heute. Ich entsäuerte meinen Körper über neun Monate hinweg mit Infusionen. Ich sanierte meinen Darm, befreite ihn von Parasiten und Candida. Ich korrigierte meine Haltung durch CMD-Schienentherapie und eine gezielte HWS-Kurvenkorrektur.
All das – und noch mehr – habe ich mühevoll gemacht. Ich war im Jahr bis zu 5000 Kilometer unterwegs, nur um die richtigen Behandlungen zu finden. Es war kein gerader Weg. Es war ein Weg voller Zweifel, Rückschläge und Kosten. Aber ich bin ihn gegangen. Und ich bin ihn nicht gegangen, weil ich sicher war, dass es funktioniert. Ich bin ihn gegangen, weil ich wusste, dass Aufgeben keine Option ist.
Was ich dir sagen möchte: Es lohnt sich.
Wenn du gerade an einem Punkt bist, an dem du nicht mehr weiterweißt – bleib dran. Auch wenn es aussichtslos erscheint. Auch wenn niemand dir glaubt. Auch wenn du denkst, du bist allein. Du bist es nicht. Es gibt Wege. Es gibt Hoffnung. Und manchmal beginnt Heilung genau dort, wo man sie am wenigsten erwartet: im tiefsten Tal.

Ein zufällig angezeigtes YouTube-Video von Dr. Ross Hauser brachte die Wende. Die dort beschriebenen Symptome passten perfekt zu meinem Zustand. Ich erkannte, dass die Ursache meiner Beschwerden in der Halswirbelsäule (HWS) lag.
Die Suche nach einem passenden Arzt in Europa war schwierig. Nach vielen Monaten stieß ich auf Dr. Rollbeck, der mich mit PRP-Injektionen behandelte und mir das Upright-MRT empfahl. Damit begann meine Heilungsreise – geprägt von Rückschlägen, aber auch Fortschritten.
Unterstützung durch Dr. med. Doris Gottfried
Auch meine Familie litt unter meiner Erkrankung. Doch meine Frau, Dr. med. Doris Gottfried, erkannte zunehmend die Zusammenhänge und begann eine Ausbildung in Applied Kinesiology bei:
- Der Deutschen Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology
- Der Österreichischen Ärztegesellschaft für Funktionelle Myodiagnostik
Während ihrer Ausbildung fanden wir gemeinsam neue Ansätze zur Behandlung meiner HWS-Probleme. Schritt für Schritt stellten sich Verbesserungen ein.
Ganzheitliche Sichtweise & diagnostischer Durchbruch
Ich war auch bei vier ihrer Ausbilder in Behandlung. Jeder hatte eine eigene Sichtweise, doch alle konnten Probleme an der HWS diagnostizieren. Über die Jahre haben meine Frau und ich so viel gelernt, dass sie heute meiner Meinung nach einzigartige diagnostische Ansätze bietet, die die bisherige Ärzteschaft ergänzt.
Applied Kinesiology als Schlüssel
Applied Kinesiology ist ein diagnostisches Verfahren, bei dem über Muskeltests funktionelle Störungen im Körper erkannt werden können. Dabei wird geprüft, wie der Körper auf bestimmte Reize oder Aussagen reagiert – ein schwacher Muskel zeigt eine Belastung oder Störung an.
Besonders bahnbrechend war der Moment, als meine Frau – ohne osteopathische Ausbildung – über den Muskeltest herausfand, welcher Wirbel aktuell falsch stand und in welche Richtung er geschoben werden musste, um die Situation zu entspannen. Sie fühlte die Wirbel nicht manuell, sondern ließ den Muskeltest die Richtung der Justierung anzeigen.
Der Ausschalter für neurologische Symptome
Der Effekt war verblüffend: Innerhalb von nur einer Minute nach der korrekten Justierung verschwanden meine stärksten neurologischen Symptome – darunter Angstzustände, Schweißausbrüche, Herzfrequenzerhöhungen, Atemprobleme, Übelkeit und Erbrechen. Auch wenn der Wirbel dadurch noch nicht dauerhaft stabil blieb, war dieser „Ausschalter“ ein Durchbruch. Die Möglichkeit, diese Symptome gezielt zu unterbrechen, bedeutete für mich ein Stück Kontrolle und Lebensqualität zurückzugewinnen.
Ich halte diesen Schritt für außerordentlich wichtig – denn einen Ausschalter zu finden, kann für Betroffene den entscheidenden Unterschied machen.
Spezialisierung ist entscheidend
Meiner Meinung nach reicht es nicht, zu einem erfahrenen Kinesiologen zu gehen, denn die HWS erfordert spezielle Erfahrung, um genau zu diagnostizieren. Applied Kinesiology bietet viele Möglichkeiten. Es ist wichtig zu wissen, was genau bei Kopfgelenksymptomen zu prüfen ist. Auch die Abgrenzung zu anderen Krankheiten wie Borreliose, Schwermetallvergiftung und Long Covid ist ein wichtiger Baustein.
Hinweis: In diesem Beitrag schildere ich, Uli Gottfried, meine persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen zum Thema Kopfgelenksinstabilität (CCI). Ich bin kein Arzt, und meine Ausführungen ersetzen keine medizinische Beratung oder Behandlung. Für individuelle Diagnosen und Therapien wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Ärztin oder einen Arzt.
Die erfolgreiche Behandlung von Kopfgelenksinstabilität erfordert weit mehr als die Stabilisierung der Bänder. Aus meiner Sicht ist es entscheidend, systemische Belastungen zu erkennen und auszuschließen, bevor regenerative Maßnahmen wie Prolotherapie oder Muskeltraining greifen können. Hier sind die wichtigsten Faktoren, die ich in meiner persönlichen Heilung und in meiner Praxisbeobachtung als grundlegend erlebt habe:
Ausschluss anderer Ursachen
Krankheiten wie Borreliose, Schwermetallvergiftung und Entgiftungsstörungen können das Nervensystem und insbesondere den Vagusnerv stark beeinflussen. Die Symptome ähneln oft denen der Kopfgelenksinstabilität: Schwindel, Übelkeit, Herzfrequenzprobleme, neurologische Ausfälle. Ohne eine klare Abgrenzung besteht die Gefahr, dass man an der falschen Stelle therapiert. Ich empfehle eine umfassende Diagnostik – schulmedizinisch und komplementär – um diese Ursachen sicher auszuschließen.
CMD – Craniomandibuläre Dysfunktion
Eine Fehlstellung des Kiefers kann über Muskelverspannungen und Wirbelverschiebungen der HWS den Vagusnerv irritieren. Ich habe selbst erlebt, wie eine falsch angepasste CMD-Schiene zu massiven neurologischen Symptomen führte. Ein passender Biss ist daher nicht nur für die Zahn- und Kiefergesundheit wichtig, sondern auch für die Stabilität der gesamten Halswirbelsäule. Die CMD-Behandlung sollte immer in Verbindung mit einer HWS-Diagnostik erfolgen.
Störfelder im Kopf-Hals-Bereich
Störfelder – etwa im Bereich der Mandeln, Nasennebenhöhlen, wurzelbehandelten Zähne oder des Bauchnabels – können chronische Entzündungen und Lymphstau verursachen. Diese Belastungen wirken sich direkt auf die Muskelsteuerung und die Regenerationsfähigkeit der HWS aus. Ich habe erlebt, wie die Entfernung eines wurzelbehandelten Zahns und die Behandlung der Rachentonsillen mit Kryotherapie spürbare Verbesserungen brachten.
Injury Recall – Verletzungsmuster löschen
Verletzungsmuster im Nervensystem, etwa durch frühere Unfälle oder Operationen, können die Muskelansteuerung dauerhaft stören. Die Folge: Selbst nach einer erfolgreichen Justierung kehrt der Wirbel in die Fehlstellung zurück. Die Injury Recall Technik erlaubt es, solche Muster gezielt zu identifizieren und zu löschen – ein oft unterschätzter, aber zentraler Baustein für nachhaltige Stabilität.
HWS-Kurvenkorrektur
Eine gesunde Krümmung der Halswirbelsäule ist entscheidend für die Druckverteilung, Muskelspannung und Nervenfunktion. Eine flache oder umgekehrte Kurve kann die Symptome verstärken. Die gezielte HWS-Kurvenkorrektur nach Dr. Brian Hutcheson hat mir persönlich geholfen, die biomechanischen Voraussetzungen für Heilung zu verbessern.
Stille Entzündungen reduzieren
Solange der Körper mit stillen Entzündungen beschäftigt ist, fehlen ihm die Ressourcen zur Reparatur. Ich empfehle hier die orthomolekulare Medizin, gezielte Mikronährstofftherapie und einfache Maßnahmen wie Erden beim Schlafen, um das Nervensystem zu beruhigen und die Regeneration zu fördern.
Darm und Leber entlasten
Das Entgiftungssystem spielt eine zentrale Rolle. Ein durchlässiger Darm („Leaky Gut“) kann systemische Entzündungen auslösen, die sich bis in die HWS auswirken. Die Leber wiederum muss in der Lage sein, Schadstoffe effektiv auszuleiten. Ich habe gute Erfahrungen mit Darmaufbau, Parasitenbehandlung und Leberunterstützung gemacht – oft war dies die Voraussetzung dafür, dass andere Therapien überhaupt wirken konnten.
Wenn diese Punkte optimiert sind und keine Verbesserung eintritt, kann die Prüfung und Stärkung der Bänder beginnen.
Prolotherapie-Erfahrungen:
- PRP-Injektionen: PRP (Plättchenreiches Plasma) soll Stammzellen anlocken und Heilungsreaktionen auslösen. Bei mir hat PRP nicht geholfen, da ich die obigen Punkte damals nicht berücksichtigt hatte.
- Prolotherapie: Laut Dr. Bährlener ist Prolotherapie erfolgversprechender als PRP. Chris Centeno aus den USA meint, dass die Konzentration des PRP entscheidend ist. In Deutschland sind jedoch keine Zentrifugen für eine hohe Konzentration bekannt. Daher bevorzuge ich Prolotherapie, bei der eine Zuckerlösung in die Bänder der HWS injiziert wird, um Heilungsreaktionen zu erzeugen. Es ist wichtig, zuerst alle anderen Entzündungsherde und Störfelder im Körper zu eliminieren, damit der Körper auf die Entzündungsstelle der Prolotherapie reagieren kann. Laut Umfragen in meiner Selbsthilfegruppe erfahren ca. 50 % der Personen die Prolotherapie von hinten in die HWS applizieren lassen eine Linderung. 10-15 % davon eine deutliche Besserung. Ich denke man kann diese Quote erhöhen, wenn man zuvor obiges behandelt und ausschließt.
Sollte diese Maßnahmen nicht reichen gibt es die Möglichkeit einer Stammzelleninjektion in den USA bei Chris Centeno oder auch Prolotherapie von vorne Injeziert von Ross Hausser was so in Europa nicht angeboten wird. Sicherlich geht es hier dann um viel Geld weil gleich mehrere 10.000 Euro aufgebracht werden müssen.
Für mich stellt eine Versteifung der HWS nur das Letzte Mittel der Wahl da und ich keinen bisher noch niemanden der mit einer Versteifung wieder gesund geworden ist.
Das Training der tiefen Halswirbelsäulenmuskulatur ist ein zentraler Bestandteil der Rehabilitation bei Kopfgelenksinstabilität. Doch bevor diese Muskeln gezielt aktiviert und aufgebaut werden können, müssen die Bänder ausreichend stabilisiert sein – etwa durch eine Prolotherapie oder andere regenerative Verfahren. Erst wenn die Wirbel nicht mehr stark gleiten, kann das Training der segmentalen Tiefenmuskulatur sinnvoll und beschwerdefrei durchgeführt werden.
In meiner Facebook-Selbsthilfegruppe berichten viele Betroffene, dass sie das Training nicht durchführen konnten, solange die Instabilität zu stark war – da es sonst zu verstärkten Symptomen wie Schwindel, Schmerzen oder neurologischen Reaktionen kam.
Gleichzeitig zeigen die Umfragen in der Gruppe, dass bei etwa 50 % der Mitglieder eine spürbare Besserung durch das Training erzielt wurde, und bei rund 15 % sogar eine signifikante Verbesserung – teils auch ohne vorherige Prolotherapie. Dennoch empfehle ich persönlich, zuerst die Bänder zu stabilisieren, um eine sichere Grundlage für den Muskelaufbau zu schaffen. Denn nur auf einem stabilen Fundament kann die Tiefenmuskulatur ihre volle Funktion entfalten und zur nachhaltigen Stabilisierung der HWS beitragen.
Während meines Krankheitsverlaufs begann ich, mich mit Themen zu beschäftigen, die ich früher als esoterisch abgetan hätte. Im Rückblick erkannte ich, dass viele dieser Ansätze tatsächlich Substanz haben.
Glaubensarbeit: Der Einfluss innerer Überzeugungen
Es geht nicht unbedingt um den Glauben an einen Gott – obwohl das hilfreich sein kann. Vielmehr geht es um tief verankerte Glaubenssätze, die unser Verhalten und unsere Gesundheit beeinflussen. Bei einer kinesiologischen Testung reagierte ich mit einem schwachen Muskel auf den Satz: „Ich darf gesund und glücklich sein.“ Das zeigte, dass mein Unterbewusstsein diesen Satz ablehnte.
Weder Psychotherapie noch Hypnose hätten diesen Glaubenssatz so klar sichtbar gemacht. Um ihn zu verändern, sprach ich über mehrere Monate täglich einen positiven Satz. Nach etwa drei Monaten zeigte mein Körper keine Schwäche mehr bei diesem Satz – ein Zeichen für die erfolgreiche Umprogrammierung meines inneren Musters.
Unterdrückte Gefühle und ihre körperlichen Auswirkungen
Auch unterdrückte Emotionen lassen sich mit Kinesiologie erkennen. Bei mir zeigte sich Wut und Zorn in der Leber sowie ein Gefühl der Einsamkeit in der Schilddrüse. Ein erfahrener Therapeut (nicht meine Frau) stellte fest, dass dort eine Seele feststeckte.
Nach gezielten Fragen fanden wir heraus, dass es sich um meine ungeborene Zwillingsschwester handelte, die im Familiensystem integriert werden wollte. Sie war vermutlich im zweiten Schwangerschaftsmonat verstorben. Wir gaben ihr den Namen Frida und führten sie symbolisch ins Licht.
Spürbare Veränderungen nach der Behandlung
Direkt nach der Behandlung fühlte ich mich nicht wie neu geboren, aber ich bemerkte eine subtile Veränderung. Vier Wochen später sprach mich meine Mutter an und sagte, ich wirke fröhlicher. Erst da erinnerte ich mich wieder an die Sitzung mit der Seele.
Obwohl ich naturwissenschaftlich geprägt bin, denke ich mit gemischten Gefühlen an diese Erfahrung zurück – und erkenne ihren Wert.
Auf meinem YouTube-Kanal teile ich persönliche Erfahrungen, medizinisches Hintergrundwissen und praktische Einblicke in die ganzheitliche Behandlung mit Applied Kinesiology. In ausfürlichen Videos erkläre ich komplexe Zusammenhänge verständlich und zeige anhand echter Fallbeispiele, wie körperliche Symptome mit emotionalen oder systemischen Ursachen zusammenhängen können.
Viele Betroffene suchen Hilfe, rennen von Arzt zu Arzt, probieren verschiedene Therapien – und brechen sie oft zu früh ab. Am Ende heißt es dann: „Das hat mir nicht geholfen.“ Doch echte Heilung ist kein schneller Prozess. Sie erfordert Geduld, einen eisernen Willen und die Bereitschaft, sich selbst tief mit dem eigenen Körper und Geist auseinanderzusetzen.
In meiner Erfahrung muss man sich regelrecht in die eigene Gesundheit einarbeiten – ja, manchmal sogar selbst zum „Arzt“ für sich werden. Das bedeutet, Zusammenhänge zu verstehen, Muster zu erkennen und aktiv an der eigenen Genesung mitzuwirken. Wer sich mit Entschlossenheit auf diesen Weg begibt, wird belohnt: nicht mit schnellen Lösungen, sondern mit echter, nachhaltiger Veränderung.
Eine ausführliche Beschreibung der Inhalte und des Aufbaus meiner Webseite finden Sie auf einer eigenen Seite hier:
CCI youtube Kanal – Kopfgelenksinstabilität
Die von Dr. Uli Gottfried gegründete CCI-Selbsthilfegruppe auf Facebook bietet Menschen mit Kopfgelenksinstabilität (CCI) einen geschützten Raum für Austausch, Unterstützung und gegenseitige Hilfe. Mit inzwischen rund 1000 Mitgliedern zählt sie zu den größten deutschsprachigen Plattformen zu diesem Thema.
In der Gruppe teilen Mitglieder ihre persönlichen Erfahrungen, geben praktische Tipps für den Alltag und helfen sich gegenseitig bei der Bewältigung dieser oft verkannten Erkrankung. Viele von ihnen haben selbst eine lange medizinische Reise hinter sich und bringen wertvolles Wissen mit. Darunter befinden sich auch erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten, die sich aktiv einbringen und bei Fragen weiterhelfen.
Die Gruppe ist nicht öffentlich. Der Zugang erfolgt nach Genehmigung durch die Administratoren. Beiträge können auch anonym gepostet werden, um Ihre Privatsphäre zu schützen.
Wenn Sie sich gerade allein fühlen, nicht weiterwissen oder einfach jemanden suchen, der Ihre Situation versteht – kommen Sie in die Gruppe. Der Austausch ist herzlich, ehrlich und fachlich fundiert. Sie werden überrascht sein, wie viel Unterstützung möglich ist, wenn man sich mit anderen Betroffenen vernetzt.
Seit 2024 gibt es in Deutschland erstmals einen offiziellen Selbsthilfeverein für Menschen mit Kopfgelenksinstabilität (CCI) und atlantoaxialer Instabilität (AAI): die CCI/AAI Initiative e.V.. Der Verein wurde von Betroffenen gegründet und setzt sich für die Verbesserung der Versorgungssituation, die Förderung von Forschung und die Aufklärung über diese oft vernachlässigte Erkrankung ein.
Ziele des Vereins
- Anerkennung von CCI/AAI als Krankheitsbild in Deutschland
- Aufbau eines Ärztenetzwerks, das sich mit den Besonderheiten der Instabilität im oberen Halswirbelsäulenbereich auskennt
- Förderung von Forschung und Wissenschaft zur Diagnostik und Therapie
- Unterstützung von Patienten und Angehörigen durch Beratung, Austausch und Informationsangebote
- Kooperation mit internationalen Experten und medizinischen Fachgesellschaften
- Öffentlichkeitsarbeit, um Bewusstsein für die Erkrankung zu schaffen
Warum Mitglied werden?
Die CCI/AAI Initiative e.V. bietet Betroffenen eine starke Gemeinschaft, fundierte Informationen und konkrete Hilfe zur Selbsthilfe. Als Mitglied unterstützt du nicht nur die Ziele des Vereins, sondern erhältst auch Zugang zu exklusiven Inhalten, Veranstaltungen und einem Netzwerk von Menschen, die deine Situation verstehen.
Jetzt Mitglied werden und gemeinsam etwas bewegen:
cci-aai-initiative.de

Kopfgelenksinstabilität und Kopfgelenkssymptome sind aus meiner Sicht ein äußerst komplexes Krankheitsbild. Es handelt sich um eine Multisystemerkrankung, bei der nicht nur die Bänder betroffen sind, sondern auch das Nervensystem, die Muskulatur, der Stoffwechsel und emotionale Faktoren eine Rolle spielen.
Selbst wenn die Ursache – etwa durch einen Autounfall – eindeutig in einer Schädigung der Bänder liegt, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass eine alleinige Bänderbehandlung zur vollständigen Genesung führt. Vielmehr müssen alle zuvor genannten Aspekte ganzheitlich geprüft und behandelt werden. Das macht den Heilungsprozess langwierig, aber möglich.
Meine Frau, Dr. med. Doris Gottfried, hat durch die gemeinsame Arbeit mit mir und vielen anderen Kopfgelenkspatienten umfassende Erfahrung gesammelt. Sie verfügt über die nötige Kompetenz, um Kopfgelenksinstabilität ganzheitlich zu diagnostizieren und individuelle Heilungsansätze zu entwickeln. Was es braucht, ist Geduld, zielgerichtetes Arbeiten und die Bereitschaft, sich mit Körper, Seele und Geist auseinanderzusetzen.
Ich verdanke meiner Frau, Dr. med. Doris Gottfried, meine zweite Chance im Leben. Heute darf ich meinen Sohn beim Erwachsenwerden begleiten – dafür bin ich unendlich dankbar.
Ich kann meine Frau uneingeschränkt empfehlen – als Ärztin und als Mensch.
Uli Gottfried
Wenn Sie sich intensiver mit den Ursachen, Zusammenhängen und ganzheitlichen Heilungsansätzen bei Kopfgelenksinstabilität beschäftigen möchten, finden Sie auf der Webseite von Dr. med. Doris Gottfried fundierte Informationen zu zahlreichen ergänzenden Themen. Die Inhalte basieren auf langjähriger Praxiserfahrung und wissenschaftlicher Ausbildung und bieten wertvolle Impulse für Betroffene, Angehörige und interessierte Fachpersonen.
Ich lade Sie herzlich ein, weiterzulesen und sich zu informieren. Denn wer die Zusammenhänge versteht, kann gezielter handeln – und damit den Weg zur Besserung aktiv mitgestalten.
- Kopfgelenksinstabilität
- CMD (Craniomandibuläre Dysfunktion)
- HWS-Kurvenkorrektur nach Dr. Brian Hutcheson
- Injury Recall Technik
- Bioidentische Hormone
- Chelattherapie
- Borreliose
- Entgiften
- Grounding und Erden
- Mitochondrien
- Nitrosativer Stress
- Oxidativer Stress
- Omega 3
- Probiotika
- Vitamin B
- Coenzym Q10
Ich kann meine Frau uneingeschränkt empfehlen – als Ärztin und als Mensch.
Uli Gottfried

Nach drei Jahren intensiver Heilungsphase kann ich heute wieder Fahrrad fahren – ein Moment voller Freiheit, Lebendigkeit und Dankbarkeit. Im Bild rechts habe ich diesen besonderen Moment meines ersten Mountainbike-Ausflugs festgehalten. Leider kann man die Emotionen, die ich in diesem Augenblick empfand, nicht direkt sehen – aber für mich war es ein überwältigendes Gefühl. Es war ein Wendepunkt, den ich nie vergessen werde.
Der nächste Schritt ist das regelmäßige Joggen. Ich stelle meinen Laufstil auf Mittelfußlaufen um und arbeite gezielt an meiner Kopfhaltung, um die Belastung der Halswirbelsäule zu reduzieren. Beim Laufen merke ich jedoch noch häufig, dass einzelne Wirbel – insbesondere im oberen Bereich – in Fehlstellung geraten. Diese Fehlstellungen können neurologische Symptome wie Angstgefühle und Alpträume auslösen. Es ist ein sensibles System, das auf kleinste Veränderungen reagiert.
Zusätzlich treten Schmerzen im Trapezius und im Sternocleidomastoideus auf der linken Seite auf – besonders bei Kopfrotation oder Seitneigung. Diese Muskelgruppen sind bei mir dauerhaft gereizt und reagieren empfindlich auf Belastung.
Trotz dieser Herausforderungen hatte ich bereits Laufrunden, bei denen alles stabil blieb – und ich danach ruhig schlafen konnte. Das zeigt mir: Es ist möglich. Und ich habe großes Glück, dass mir jemand regelmäßig kostenlos die Wirbel justiert. Wäre ich auf osteopathische Behandlungen angewiesen und müsste für jeden Versuch 100 Euro zahlen, wäre der Weg zurück zum Joggen deutlich schwerer. Diese Unterstützung ist für mich ein Geschenk.
Ich arbeite mit Hochdruck und Entschlossenheit weiter – denn jeder Fortschritt ist ein Zeichen dafür, dass Heilung kein Zustand, sondern ein aktiver Prozess ist.
Die Kopfgelenksinstabilität hat mein Leben über Jahre hinweg geprägt – körperlich, emotional und existenziell. Doch ich habe gelernt, dass Heilung möglich ist, wenn man bereit ist, die Zusammenhänge zu erkennen und ganzheitlich zu handeln. Es braucht Geduld, Eigenverantwortung und den Mut, neue Wege zu gehen.
Ich hoffe, dass dieser Erfahrungsbericht und die gesammelten Informationen anderen Betroffenen helfen, ihre Symptome besser zu verstehen und gezielt nach Lösungen zu suchen. Die Kombination aus schulmedizinischer Diagnostik, komplementären Verfahren und systemischer Betrachtung hat mir persönlich den Weg zurück in die Bewegung und Lebensfreude eröffnet.
Wenn Sie unter Kopfgelenksinstabilität leiden oder jemanden kennen, der betroffen ist: Sie sind nicht allein. Es gibt Wege – und manchmal beginnt Heilung genau dort, wo Sie sie am wenigsten erwarten.
Uli Gottfried
Was ist Kopfgelenksinstabilität (CCI)?
CCI steht für Craniocervicale Instabilität. Sie beschreibt eine übermäßige Beweglichkeit im Bereich der oberen Halswirbelsäule, insbesondere zwischen Schädel, Atlas (C1) und Axis (C2). Diese Instabilität kann neurologische, vegetative und orthopädische Symptome verursachen und wird in Deutschland bislang nicht als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt.
Was ist AAI?
AAI steht für Atlantoaxiale Instabilität. Sie betrifft speziell das Gelenk zwischen Atlas (C1) und Axis (C2). Während CCI den gesamten Übergang vom Schädel zur Halswirbelsäule umfasst, fokussiert AAI auf die Instabilität innerhalb dieses Gelenks. Beide Formen können ähnliche Symptome verursachen, erfordern aber unterschiedliche diagnostische und therapeutische Ansätze.
Kann Kopfgelenksinstabilität auch ohne Unfall entstehen?
Ja. Neben traumatischen Ursachen wie Schleudertrauma oder Stürzen kann CCI auch durch chronische Fehlhaltungen, genetische Bindegewebsschwächen (z. B. Ehlers-Danlos-Syndrom), entzündliche Prozesse oder funktionelle Störungen wie CMD entstehen. Auch hormonelle Dysbalancen und systemische Belastungen können die Bandstrukturen schwächen.
Was sind Kopfgelenkssymptome – und braucht es dazu zwingend eine Instabilität?
Kopfgelenkssymptome wie Schwindel, Sehstörungen, Herzrasen, Übelkeit, Atemnot oder neurologische Ausfälle können auch ohne strukturelle Instabilität auftreten – etwa durch muskuläre Dysbalancen, Fehlstellungen, CMD oder Vagusreizungen. Eine Instabilität ist nicht zwingend erforderlich, sollte aber bei komplexen oder therapieresistenten Beschwerden abgeklärt werden.
Welche Rolle spielt die HWS-Kurvenkorrektur nach Dr. Brian Hutcheson?
Eine gesunde Krümmung der Halswirbelsäule ist entscheidend für die Druckverteilung, Muskelspannung und Nervenfunktion. Dr. Brian Hutcheson entwickelte ein gezieltes Trainingskonzept zur Wiederherstellung der natürlichen HWS-Kurve. Diese biomechanische Optimierung kann die Voraussetzung für eine stabile Wirbelsäule und nachhaltige Heilung schaffen.
Was ist Injury Recall und wie funktioniert er?
Injury Recall ist eine Technik zur Löschung von alten Verletzungsmustern im Nervensystem. Diese Muster können die Muskelsteuerung stören und Fehlstellungen begünstigen. Durch gezielte Reize und kinesiologische Tests können diese Muster erkannt und gelöst werden.
Was ist erweiterter Injury Recall?
Der erweiterte Injury Recall geht über einzelne Verletzungen hinaus und bezieht systemische Traumata, Operationsfolgen oder emotionale Blockaden mit ein. Er wird oft in Kombination mit Applied Kinesiology eingesetzt, um tiefere neurologische Muster zu lösen und die Selbstregulation des Körpers zu verbessern.
Was sind Störfelder – und wie beeinflussen sie die HWS?
Störfelder sind chronisch gereizte Gewebeareale, z. B. durch wurzelbehandelte Zähne, Narben, Mandeln oder den Bauchnabel. Sie verursachen stille Entzündungen, die den Lymphfluss im Gewebe behindern und die Entgiftung stören. Über das vegetative Nervensystem senden sie fehlerhafte Signale, die zu gestörter Muskel- und Faszienansteuerung führen. Die Folge sind asymmetrische Muskelzüge, Wirbelfehlstellungen und eine Verschlechterung der HWS-Stabilität. Ihre Behandlung – z. B. durch Neuraltherapie oder Kryotherapie – kann die Muskelkoordination verbessern und die Grundlage für eine erfolgreiche HWS-Therapie schaffen.
Wie hilft Mikronährstofftherapie bei Kopfgelenksinstabilität?
Mikronährstoffe wie Magnesium, Zink, Omega-3, Vitamin B-Komplex, Coenzym Q10 und Antioxidantien unterstützen die Zellregeneration, reduzieren Entzündungen und stärken das Bindegewebe. Eine gezielte orthomolekulare Therapie kann die Heilung der Bänder und die Funktion des Nervensystems fördern.
Welche Rolle spielen die Arteria vertebralis und die Vena jugularis bei CCI?
Bei einer Atlasverschiebung kann es zu einer mechanischen Kompression der Arteria vertebralis kommen, die das Gehirn mit Sauerstoff versorgt. Dies kann zu Schwindel, Sehstörungen und neurologischen Ausfällen führen. Auch die Vena jugularis, die für die venöse Drainage des Gehirns zuständig ist, kann durch Fehlstellungen beeinträchtigt werden, was zu einem Rückstau und erhöhter Druckbelastung im Schädel führen kann.
AAI (Atlantoaxiale Instabilität)
Instabilität zwischen Atlas (C1) und Axis (C2), die neurologische und orthopädische Beschwerden verursachen kann. Häufig Teil der craniocervicalen Instabilität.
Alarbänder (Ligamenta alaria)
Kurze Bänder, die den Dens axis mit dem Schädel verbinden. Sie begrenzen die Rotation des Kopfes und stabilisieren die Kopfgelenke.
Atlasfehlstellung
Fehlposition des ersten Halswirbels, die Nerven, Gefäße und Muskeln beeinträchtigen kann. Häufige Ursache für Schwindel, Sehstörungen und Haltungsschäden.
Autonome Tiefenmuskulatur der oberen HWS
Fachbegriff: subokzipitale Muskulatur. Diese tief liegenden Muskeln (z. B. M. rectus capitis posterior, M. obliquus capitis) sind entscheidend für die feine Steuerung und Stabilisierung der Kopfgelenke.
Basilarinvagination
Fehlstellung, bei der die obere Halswirbelsäule in die Schädelbasis hineinragt. Kann zu Hirnstammkompression und neurologischen Ausfällen führen.
Bioidentische Hormone
Hormone, die in Struktur und Wirkung den körpereigenen entsprechen. Sie werden zur Regulation von Zyklus, Stimmung und Gewebeheilung eingesetzt.
Chiari-Malformation Typ I
Fehlbildung, bei der Teile des Kleinhirns in den Spinalkanal verlagert sind. Muss von Tonsillenektopie bei CCI abgegrenzt werden.
CMD (Craniomandibuläre Dysfunktion)
Fehlfunktion im Kiefergelenk, die über Muskelketten die Kopfgelenke destabilisieren kann. Häufige Ursache bei CCI.
Cervicomedulläres Syndrom
Reizung des Hirnstamms und oberen Rückenmarks durch Instabilität im Übergang zwischen Schädel und Halswirbelsäule.
Dens axis
Zahnförmiger Fortsatz des zweiten Halswirbels (C2), zentral für die Rotationsbewegung des Kopfes. Wird durch Bänder wie das Ligamentum transversum stabilisiert.
Dysautonomie
Störung des vegetativen Nervensystems, häufig bei CCI. Symptome sind Herzrasen, Atemnot, Kreislaufprobleme und Temperaturdysregulation.
Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS)
Genetische Bindegewebserkrankung, die zu übermäßiger Gelenkbeweglichkeit und Instabilität führen kann. Häufige Ursache für CCI.
Entgiftung
Therapeutischer Prozess zur Ausleitung von Schadstoffen wie Schwermetallen oder Umweltgiften. Unterstützt die Zellregeneration und Selbstregulation.
Faszienverklebung
Verklebung des Bindegewebes, die Beweglichkeit einschränkt und Fehlhaltungen begünstigt. Kann bei CCI die Muskelkoordination stören.
Histaminintoleranz
Unverträglichkeit gegenüber Histamin, einem Botenstoff. Führt zu vielfältigen Symptomen und kann durch Darmdysbiose, hormonelle Dysregulation oder Stress verstärkt werden.
Injury Recall Technik
Kinesiologische Methode zur Löschung gespeicherter Verletzungsmuster im Nervensystem. Verbessert Muskelsteuerung und Haltung.
Erweiterte Injury Recall Technik
Bezieht systemische Traumata, Operationsfolgen und emotionale Blockaden mit ein. Wird bei komplexen CCI-Fällen eingesetzt.
Kryotherapie
Behandlung mit extremer Kälte zur Regeneration und Störfeldbehandlung. Bei CCI z. B. an Mandeln oder Narben eingesetzt.
Ligamentum transversum atlantis
Querband, das den Dens axis am Atlas fixiert. Zentrale Struktur zur Verhinderung von Rückenmarkskompression.
Longus capitis
Tiefliegender Halsmuskel an der Vorderseite der Wirbelsäule. Beugt den Kopf und stabilisiert die Kopfgelenke.
Marfan-Syndrom
Erbkrankheit des Bindegewebes, die zu Instabilitäten im Bereich der Wirbelsäule führen kann. Wird als mögliche Ursache für CCI diskutiert.
Membrana tectoria
Bandstruktur, die vom Axis zur Schädelbasis zieht. Verstärkt die hintere Begrenzung des Spinalkanals und schützt das Rückenmark.
Mikronährstofftherapie
Gezielte Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien zur Unterstützung von Gewebeheilung und Nervenfunktion.
Musculi scaleni (Skalene-Muskeln)
Drei tiefliegende Halsmuskeln, die die Halswirbelsäule stabilisieren und als Atemhilfsmuskeln wirken. Bei CCI oft überlastet oder asymmetrisch aktiviert.
Nitrosativer Stress
Zellschädigung durch überschüssiges Stickstoffmonoxid (NO) und Peroxinitrit. Führt zu mitochondrialer Dysfunktion und neurologischen Symptomen.
Orthomolekulare Medizin
Therapie mit Mikronährstoffen zur Optimierung biochemischer Prozesse. Unterstützt Zellfunktion, Entgiftung und Gewebeheilung.
Oxidativer Stress
Ungleichgewicht zwischen freien Radikalen und Antioxidantien. Führt zu Zellschäden, Entzündungen und chronischen Erkrankungen.
Peroxinitrit
Aggressives Molekül, das aus NO und Superoxid entsteht. Verursacht Enzymschäden, Mitochondriopathien und neurologische Symptome.
Pivoting
Abnormes Vorwärtsgleiten des Kopfes gegenüber dem Atlas bei Beugebewegungen. Typisches radiologisches Zeichen bei CCI.
PRP (Platelet-Rich Plasma)
Eigenbluttherapie mit konzentrierten Blutplättchen zur Geweberegeneration. Unterstützt die Prolotherapie.
Prolotherapie
Regenerative Injektionstherapie zur Stabilisierung von Bändern. Bei CCI oft Voraussetzung für erfolgreiches Muskeltraining.
Sternocleidomastoideus
Großer Halsmuskel, der bei Fehlhaltungen und Atlasfehlstellungen verspannt sein kann. Ursache für Schmerzen, Schwindel und Sehstörungen.
Tonsillenektopie
Tiefertreten der Kleinhirntonsillen in den Spinalkanal. Kann bei CCI auftreten und zu Hirnstammreizungen führen.
Trapezius
Rücken- und Nackenmuskel, der bei Haltungsstörungen und Stress überlastet ist. Verspannungen können Kopfschmerzen und Bewegungseinschränkungen verursachen.
Vena jugularis
Große Halsvene, die das Gehirn entstaut. Bei Atlasfehlstellung kann sie eingeengt werden, was zu Druckgefühl und neurologischen Symptomen führt.
Autor: Uli Gottfried | Letzte Aktualisierung: 02.10.2025