Schilddrüsenprobleme ganzheitlich erkennen & behandeln in Erlangen (Nürnberg/Fürth) – Hormone regulieren
Schilddrüsenprobleme wie Hashimoto, Morbus Basedow oder hormonelle Dysbalancen betreffen viele Menschen – oft mit unspezifischen Symptomen wie Erschöpfung, Gewichtsschwankungen oder innerer Unruhe. In meiner ganzheitlich ausgerichteten Privatpraxis in Erlangen (Raum Nürnberg/Fürth) steht die individuelle Ursachenforschung im Mittelpunkt. Neben schulmedizinischer Diagnostik kommen bioidentische Hormone, orthomolekulare Medizin, Schwermetallanalysen, Ultraschalluntersuchungen und die Erkennung von Störfeldern zum Einsatz.
Besonderes Augenmerk liegt auf der Verbindung zwischen Schilddrüse, Darm, Entgiftung und hormonellen Steuerzentren wie Hypophyse und Hypothalamus. Ziel ist es, die Schilddrüsenfunktion zu stabilisieren, das hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.
Schilddrüsenprobleme ganzheitlich erkennen & behandeln – Ursachen verstehen, Hormone regulieren, Wohlbefinden stärken. Erfahren Sie im weiteren Verlauf, wie dieser ganzheitliche Ansatz helfen kann, Schilddrüsenprobleme gezielt zu erkennen und individuell zu behandeln.
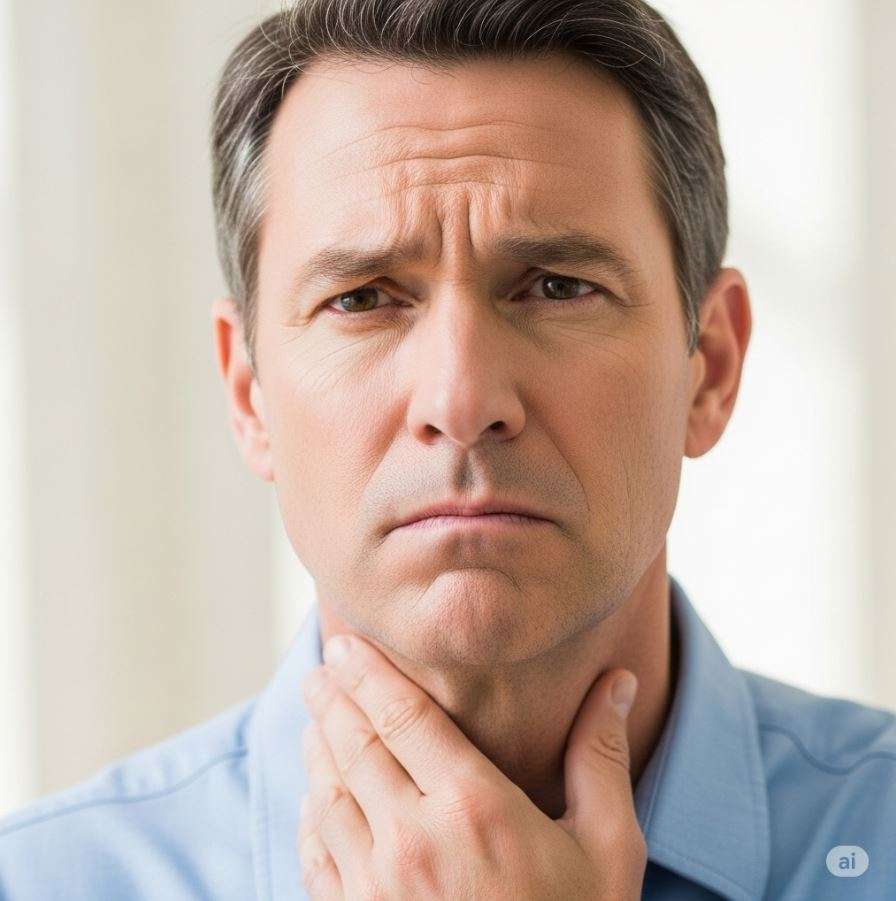
Funktion der Schilddrüse
Die Schilddrüse ist eine kleine, schmetterlingsförmige Drüse, die sich im vorderen Halsbereich unterhalb des Kehlkopfs befindet. Sie spielt eine zentrale Rolle im Stoffwechsel, Wachstum und der Reifung des Körpers. Die Schilddrüse produziert die Hormone Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4), die in die Blutbahn abgegeben werden und zahlreiche Körperfunktionen regulieren.
Die Produktion dieser Hormone wird durch einen komplexen Regelkreis gesteuert, der vom Hypothalamus und der Hypophyse im Gehirn kontrolliert wird. Diese Hormone beeinflussen den Energiehaushalt des Körpers, die Körpertemperatur, den Herzschlag, die Gehirnreifung bei Kindern und das Wachstum.
Schilddrüsenprobleme
Es gibt verschiedene Arten von Schilddrüsenproblemen, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken können. Zu den häufigsten gehören:
Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose): Bei einer Unterfunktion produziert die Schilddrüse zu wenig Hormone. Dies kann zu Müdigkeit, Gewichtszunahme, trockener Haut, spröden Haaren und einem geschwollenen Gesicht führen. Betroffene fühlen sich oft abgeschlagen und antriebslos.
Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose): Bei einer Überfunktion produziert die Schilddrüse zu viele Hormone. Dies kann zu Gewichtsverlust, Herzrasen, Zittern, Nervosität und Schlaflosigkeit führen. Betroffene sind häufig gereizt und fühlen sich überdreht.
Hashimoto-Thyreoiditis: Dies ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die Schilddrüse angreift und ihre Funktion beeinträchtigt. Symptome können Müdigkeit, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen sein.
Morbus Basedow: Eine weitere Autoimmunerkrankung, die zu einer Überfunktion der Schilddrüse führt. Symptome sind Herzrasen, Gewichtsverlust und Augenprobleme.
Schilddrüsenknoten und -tumore: Diese können gutartig oder bösartig sein und die Funktion der Schilddrüse beeinträchtigen.
Symptome und Gefühle der Betroffenen bei Schilddrüsenprobleme
Schilddrüsenprobleme können eine Vielzahl von Symptomen verursachen, die sowohl körperlich als auch emotional belastend sind. Hier sind einige häufige Symptome:
- Müdigkeit und Erschöpfung: Trotz ausreichendem Schlaf fühlen sich Betroffene oft müde und erschöpft.
- Gewichtsschwankungen: Plötzliche Gewichtszunahme oder -verlust können auf eine Schilddrüsenstörung hinweisen.
- Stimmungsschwankungen und Depressionen: Ein unausgeglichener Hormonhaushalt kann zu emotionalen Problemen wie Depressionen und Angstzuständen führen.
- Kälte- oder Hitzesensibilität: Betroffene können ungewöhnlich empfindlich auf Kälte oder Hitze reagieren.
- Haut-, Haar- und Nagelveränderungen: Trockene Haut, Haarausfall und brüchige Nägel sind häufige Anzeichen.
- Herzrasen oder langsamer Herzschlag: Veränderungen im Herzschlag können ebenfalls auf Schilddrüsenprobleme hinweisen.
Schilddrüsenprobleme: Schulmedizinische Ansätze

Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose)
Die schulmedizinische Behandlung der Schilddrüsenunterfunktion zielt darauf ab, den Mangel an Schilddrüsenhormonen auszugleichen. Dies wird in der Regel durch die tägliche Einnahme von synthetischem Thyroxin (T4) erreicht. Das häufigste Medikament ist L-Thyroxin, welches die fehlenden Hormone ersetzt und die Symptome lindert. Die Dosierung wird individuell angepasst und regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass die Hormonspiegel im Blut im normalen Bereich liegen. Bei einigen Patienten kann zusätzlich Trijodthyronin (T3) verabreicht werden, wenn die alleinige Gabe von T4 nicht ausreicht.
Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose)
Die Behandlung der Schilddrüsenüberfunktion hängt von der Ursache und dem Schweregrad der Erkrankung ab. Es gibt drei Hauptansätze:
Medikamentöse Therapie: Die häufigsten Medikamente sind Thyreostatika wie Thiamazol und Carbimazol, die die Produktion von Schilddrüsenhormonen hemmen. Bei Unverträglichkeit dieser Medikamente kann auch Propylthiouracil eingesetzt werden. Zusätzlich können Betablocker verschrieben werden, um Symptome wie Herzrasen und Zittern zu lindern.
Radiojodtherapie: Diese Behandlung nutzt radioaktives Jod, das von der Schilddrüse aufgenommen wird und die überaktiven Zellen zerstört. Dies führt zu einer Reduktion der Hormonproduktion und kann langfristig zur Normalisierung der Schilddrüsenfunktion führen.
Operation: In schweren Fällen oder wenn andere Therapien nicht erfolgreich sind, kann eine Thyreoidektomie (Entfernung der Schilddrüse) notwendig sein. Dies ist besonders bei großen Knoten oder Verdacht auf Krebs der Fall.
Hashimoto-Thyreoiditis
Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die Schilddrüse angreift. Die Behandlung konzentriert sich auf die Symptome und die Regulierung der Schilddrüsenfunktion:
Hormontherapie: Bei einer resultierenden Hypothyreose wird L-Thyroxin verabreicht, um den Hormonmangel auszugleichen.
Entzündungshemmende Medikamente: In akuten Entzündungsphasen können nichtsteroidale Antiphlogistika oder seltener steroidale Antiphlogistika eingesetzt werden, um die Entzündung zu reduzieren.
Morbus Basedow
Morbus Basedow ist eine Autoimmunerkrankung, die zu einer Überfunktion der Schilddrüse führt. Die Behandlung umfasst:
Thyreostatika: Medikamente wie Thiamazol und Carbimazol werden eingesetzt, um die Produktion von Schilddrüsenhormonen zu hemmen.
Betablocker: Diese Medikamente helfen, die Herzfrequenz zu senken und Symptome wie Zittern und Nervosität zu lindern.
Radiojodtherapie und Operation: Bei ausbleibendem Therapieerfolg oder schweren Fällen kann eine Radiojodtherapie oder eine operative Entfernung der Schilddrüse notwendig sein.
Schilddrüsenknoten und -tumoren
Die Behandlung von Schilddrüsenknoten und -tumoren hängt von ihrer Größe, Anzahl und ob sie gutartig oder bösartig sind:
Überwachung und Kontrolle: Gutartige Knoten, die keine Beschwerden verursachen, werden regelmäßig per Ultraschall überwacht.
Medikamentöse Therapie: Bei hormonproduzierenden Knoten können Thyreostatika eingesetzt werden, um die Hormonproduktion zu regulieren.
Operation: Große Knoten, die auf umliegende Strukturen drücken oder bösartig sind, werden operativ entfernt.
Diese schulmedizinischen Ansätze bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die unterschiedlichen Schilddrüsenprobleme effektiv zu behandeln und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Wenn Sie Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Studien zu Schilddrüsenproblemen: Ganzheitlich & evidenzbasiert
1) Myo‑Inositol + Selen bei Hashimoto und subklinischer Hypothyreose
Kombinationen aus Myo‑Inositol und Selen senken bei Patientinnen und Patienten mit Hashimoto‑Antikörpern häufig den TSH‑Wert und verbessern Antikörperprofile—teils bis zur Rückkehr in den Euthyreose‑Bereich. Das zeigen randomisierte Studien und multizentrische Beobachtungen über 3–6 Monate. Viele Betroffene berichten zudem über eine Besserung des Befindens und eine Zyklusregulation.
Quelle: Nordio M., Pajalich R. (2013) Journal of Thyroid Research; Nordio M., Basciani S. (2017) European Review for Medical and Pharmacological Sciences; Payer J. et al. (2022) Frontiers in Endocrinology.
2) Selen bei Hashimoto (Meta‑Analyse randomisierter Studien 2024)
Selen kann TPO‑Antikörper deutlich senken und bei Patientinnen und Patienten ohne Schilddrüsenhormonersatz den TSH moderat verbessern; Nebenwirkungen waren ähnlich wie unter Placebo. Die Gesamtevidenz wurde als „moderat“ eingeschätzt. Damit ist Selen als begleitende Maßnahme bei Hashimoto gut vertretbar, besonders bei nachgewiesen unzureichender Versorgung.
Quelle: Huwiler V.V. et al. (2024) Thyroid.
3) Vitamin D bei Hashimoto (gemischte Evidenz, Tendenz zur Antikörpersenkung)
Mehrere Meta‑Analysen zeigen: Vitamin‑D‑Gaben können TPO/Tg‑Antikörper senken—vor allem bei Laufzeiten > 12 Wochen; Effekte auf TSH/FT3/FT4 sind uneinheitlich. Einzelne randomisierte Studien fanden keinen klaren Funktions‑Effekt. Fazit: Vitamin D kann sinnvoll sein, wenn ein Mangel vorliegt—Dosis und Dauer sollten individuell festgelegt werden.
Quelle: Zhang J. et al. (2021) Journal of International Medical Research; Jiang H. et al. (2021) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics; Vahabi Anaraki P. et al. (2017) Journal of Research in Medical Sciences.
4) Mediterrane Ernährung bei Hashimoto
Die mediterrane Kost wirkt antioxidativ und entzündungshemmend und kann Antikörper, Blutfette und Lebensqualität verbessern. Pilot‑ und Interventionsdaten berichten über sinkenden oxidativen Stress und günstigere Schilddrüsenparameter. Sie ist alltagstauglich und gut mit Levothyroxin kombinierbar.
Quelle: Laganà M. et al. (2025) Nutrients; Abushady M. et al. (2024) European Congress of Endocrinology – Endocrine Abstracts.
5) Glutenfreie Ernährung bei Hashimoto (ohne Zöliakie): uneinheitliche Daten
Eine randomisierte Studie fand keine klare symptomatische Überlegenheit, teils jedoch niedrigere TSH‑Werte; Antikörperveränderungen sind inkonsistent. Reviews raten ohne Zöliakie‑Nachweis zur Zurückhaltung und zu individualisierten Testphasen mit Monitoring. Eine größere Studie untersucht derzeit den Einfluss auf Lebensqualität und Antikörper.
Quelle: Godhwani A. et al. (2023) American Family Physician – FPIN Help Desk Answers; Ülker M.T. et al. (2023) Food Science & Nutrition; Cleveland Clinic (laufende Studie, 2025) ClinicalTrials‑Registereintrag.
6) Probiotika, Mikrobiom & Schilddrüse
Bei Hashimoto finden sich häufig Mikrobiom‑Verschiebungen (Darm‑Schilddrüsen‑Achse); das stützt Lebensstil‑ und Ernährungsansätze. Probiotika verbessern nicht konsistent Hormonwerte, können aber Autoantikörper bei Morbus Basedow (TRAb) leicht senken und in Hashimoto‑Programmen die Lebensqualität steigern. Insgesamt spricht vieles für eine Mikrobiom‑freundliche Ernährung plus gezielte Probiotikagaben.
Quelle: de Freitas Cayres L.C. et al. (2021) Frontiers in Immunology; Shu Q. et al. (2024) PLOS ONE; Osowiecka K. et al. (2025) Nutrients.
7) Stress, Psyche & Autoimmunität (Mind‑Body‑Ansätze)
Stress kann Autoimmunprozesse verstärken; Patientinnen mit AITD berichten häufiger über frühe emotionale Belastungen. Mindfulness‑/CMT‑Programme senken Stressreaktivität und verbesserten in einer Pilot‑Intervention bei Hashimoto Symptome und Lebensqualität. In der Praxis sind Atem‑, Achtsamkeits‑ und Mitgefühlsübungen gut mit Medizin und Ernährung kombinierbar.
Quelle: Corso A. et al. (2023) Scientific Reports; Morton M.L. et al. (2020) Mindfulness; Portokalidou Z. et al. (2022) Mindfulness.
8) Jod: „nicht zu wenig, nicht zu viel“
Sowohl Jodmangel als auch Jodexzess können die Schilddrüse stören; zu hohe Aufnahmen stehen mit mehr Autoimmunität in Verbindung—besonders bei vorbestehender Veranlagung. Populationsdaten nach Iodsalz‑Programmen zeigen den Bedarf an genauer Steuerung und Monitoring. Für Einzelpersonen gilt: bedarfsgerechte Zufuhr, keine Hochdosen ohne Indikation.
Quelle: Teti C. et al. (2021) Immunologic Research; Khudair A. et al. (2025) Frontiers in Endocrinology.
9) L‑Carnitin (± Selen) bei Hyperthyreose (Morbus Basedow)
Als Ergänzung zu Methimazol beschleunigte L‑Carnitin + Selen in einer randomisierten Studie die TRAb‑Normalisierung und senkte die benötigte Methimazol‑Gesamtdosis; die Hormon‑Normalisierung war vergleichbar. L‑Carnitin wirkt als funktioneller Antagonist zu T3/T4 auf Zellebene und kann Symptome lindern. Für Hashimoto ist L‑Carnitin nicht etabliert; es betrifft v. a. Überfunktion.
Quelle: Rossi M. et al. (2025) Nutrients.
10) Überblick Selen + Myo‑Inositol
Neuere Übersichten deuten darauf hin, dass Selen und Myo‑Inositol—einzeln oder kombiniert—bei Autoimmunthyreoiditis TSH und Antikörper günstig beeinflussen können. Die stärkste Evidenz liegt für subklinische Hypothyreose mit Antikörperpositivität vor. Dosierung und Dauer sollten individuell und statusbasiert gewählt werden.
Quelle: Samuel C.G. et al. (2025) Life.
Fallbeispiele aus der ganzheitlichen Praxis
1) Leichte Schilddrüsenunterfunktion mit Antikörpern
Eine Patientin hatte einen leicht erhöhten TSH-Wert und Antikörper gegen die Schilddrüse. Sie bekam eine Kombination aus Myo-Inositol und Selen über mehrere Monate. Danach waren ihre Werte besser und sie fühlte sich wieder leistungsfähiger.
Quelle: Nordio M., Pajalich R. (2013); Nordio M., Basciani S. (2017).
2) Hashimoto und ständige Müdigkeit
Eine Patientin war trotz Medikamenten oft müde und nahm nicht ab. Sie stellte ihre Ernährung auf mediterrane Kost um und bewegte sich regelmäßig. Nach einigen Wochen fühlte sie sich fitter und ihre Blutwerte verbesserten sich.
Quelle: Abushady M. et al. (2024); Laganà M. et al. (2025).
3) Vitamin-D-Mangel bei Hashimoto
Eine Patientin hatte sehr niedrige Vitamin-D-Werte. Sie nahm über mehrere Wochen Vitamin D ein. Ihre Antikörper sanken und sie berichtete von mehr Energie.
Quelle: Zhang J. et al. (2021); Jiang H. et al. (2021).
4) Glutenfreie Ernährung ausprobiert
Eine Patientin wollte wissen, ob glutenfrei hilft. Sie probierte es drei Monate aus, aber die Beschwerden änderten sich kaum. Danach kehrte sie zu einer ausgewogenen Ernährung zurück.
Quelle: Godhwani A. et al. (2023); Ülker M.T. et al. (2023).
5) Hashimoto und Verdauungsprobleme
Eine Patientin hatte Hashimoto und oft Bauchbeschwerden. Sie bekam eine Ernährungsberatung und Probiotika. Nach einigen Wochen fühlte sie sich deutlich wohler und weniger müde.
Quelle: AkbariRad S. et al. (2025); de Freitas Cayres L.C. et al. (2021).
6) Erhöhte Cholesterinwerte bei Schilddrüsenunterfunktion
Ein Patient hatte leicht erhöhte Schilddrüsenwerte und hohes Cholesterin. Er nahm Myo-Inositol und Selen und stellte seine Ernährung um. Nach sechs Monaten waren die Werte besser und er fühlte sich aktiver.
Quelle: Payer J. et al. (2022).
7) Stress und Schlafprobleme bei Hashimoto
Eine Patientin war oft gestresst und schlief schlecht. Sie machte ein Achtsamkeitsprogramm mit Atemübungen. Nach einigen Wochen schlief sie besser und fühlte sich ausgeglichener.
Quelle: Portokalidou Z. et al. (2022); Morton M.L. et al. (2020).
8) Sorge wegen Jodpräparaten
Ein Patient wollte Jodkapseln aus dem Internet nehmen. Nach Beratung verzichtete er darauf und blieb bei normaler Ernährung. Seine Werte blieben stabil.
Quelle: Teti C. et al. (2021); Khudair A. et al. (2025).
9) Überfunktion mit starkem Zittern
Eine Patientin mit Morbus Basedow hatte starkes Zittern. Zusätzlich zur Standardtherapie bekam sie L-Carnitin und Selen. Die Beschwerden wurden schneller besser.
Quelle: Rossi M. et al. (2025).
10) Normale Werte, aber anhaltende Erschöpfung
Ein Patient hatte normale Schilddrüsenwerte, fühlte sich aber ständig müde. Mit Ernährungsumstellung, Bewegung und Stressabbau ging es ihm deutlich besser.
Quelle: Laganà M. et al. (2025); Morton M.L. et al. (2020).
Schilddrüsenprobleme: Mein ganzheitlicher Ansatz

Mein ganzheitlicher Ansatz zur Behandlung von Schilddrüsenproblemen berücksichtigt verschiedene Aspekte der Gesundheit und zielt darauf ab, die Ursachen der Beschwerden umfassend zu identifizieren und zu behandeln. Die folgende Aufzählung gibt Ihnen einen Eindruck meiner ganzheitlichen Behandlungsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie, dass die Beschwerden vielfältig sein können und ich die Untersuchungen noch viel breiter aufbauen kann, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Prüfung der Hormonspiegel und anderer Hormonorgane sowie Gabe von bioidentischen Hormonen
Ich beginne mit einer gründlichen Untersuchung Ihrer Hormonspiegel, um festzustellen, ob ein Ungleichgewicht vorliegt. Dabei prüfe ich auch die Funktion anderer Hormonorgane, die der Schilddrüse übergeordnet sind, wie die Hypophyse und den Hypothalamus. Diese Organe regulieren die Schilddrüsenfunktion und können bei Störungen ebenfalls behandelt werden. Bei Bedarf können bioidentische Hormone verabreicht werden, die in ihrer Struktur den körpereigenen Hormonen identisch sind und somit besonders gut verträglich sind. Diese Hormone helfen, das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen und die Symptome zu lindern.
Prüfung auf Schwermetallbelastung
Schwermetalle wie Quecksilber, Blei und Cadmium können die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen. Ich führe Tests durch, um festzustellen, ob Ihr Körper mit Schwermetallen belastet ist. Bei einer positiven Diagnose biete ich verschiedene Ausleitungsverfahren an, um die Schwermetalle sicher aus Ihrem Körper zu entfernen und die Schilddrüse zu entlasten.
Optimale Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen
Eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen ist entscheidend für die Gesundheit der Schilddrüse. Ich überprüfe, ob Ihr Körper optimal mit diesen Nährstoffen versorgt ist und biete bei Bedarf eine gezielte orthomolekulare Therapie an. Diese Therapie umfasst die Gabe von hochdosierten Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, um ein biochemisches Gleichgewicht im Körper zu fördern.
Untersuchung der Schilddrüse mit Ultraschall
Die Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse ist eine strahlenfreie und schmerzlose Methode, um die Struktur und Größe der Schilddrüse sowie mögliche Knoten oder Zysten zu beurteilen. Diese Untersuchung hilft mir, krankhafte Veränderungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln.
Berücksichtigung von Störfeldern
Störfelder sind chronische Entzündungen oder Irritationen im Körper, die die Gesundheit beeinträchtigen können. Ich untersuche, ob solche Störfelder vorhanden sind und biete entsprechende Behandlungen an, um diese zu beseitigen und die Schilddrüsenfunktion zu verbessern.
Einsatz von Heilpflanzen
Heilpflanzenkönnen die Schilddrüsenfunktion unterstützen und Symptome lindern. Hier sind vier Heilpflanzen, die besonders hilfreich sind:
- Johanniskraut: Wirkt stimmungsaufhellend und kann bei Hypothyreose helfen, depressive Verstimmungen zu lindern.
- Cayennepfeffer: Fördert den Stoffwechsel und kann die Schilddrüsenfunktion aktivieren.
- Ingwer: Unterstützt die Verdauung und kann entzündungshemmend wirken.
- Ginseng: Kann die Energie steigern und die allgemeine Gesundheit fördern.
Schilddrüsenprobleme: Kommen Sie zu mir in die Praxis
Mein ganzheitlicher Ansatz zielt darauf ab, Ihre Gesundheit umfassend zu verbessern und die Ursachen Ihrer Schilddrüsenprobleme gezielt zu behandeln. Kontaktieren Sie mich, um mehr über meine individuellen Therapieansätze zu erfahren und einen Termin mit mir hier in Erlangen zu vereinbaren. Ich bin für Sie da!
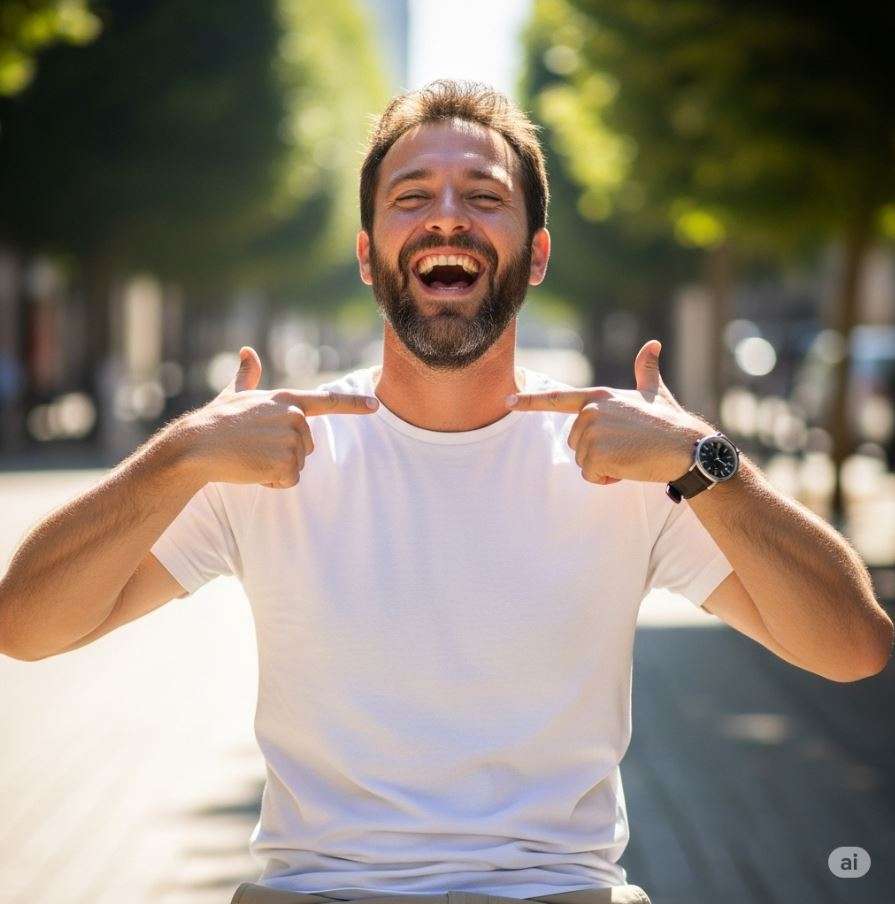
1) Was ist die Hashimoto‑Thyreoiditis?
Hashimoto ist eine häufige Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem Schilddrüsengewebe angreift. Das kann auf Dauer zu einer Unterfunktion führen (Müdigkeit, Gewichtszunahme, Frieren).
Quelle: Teti C. et al. (2021) Immunologic Research; Huwiler V.V. et al. (2024) Thyroid.
2) Muss ich bei Hashimoto immer Schilddrüsenhormone einnehmen?
Nur wenn eine Unterfunktion vorliegt oder Beschwerden und Laborwerte das nahelegen. Lebensstil, Ernährung und Mikronährstoffe können zusätzlich unterstützen, ersetzen aber die Hormongabe nicht, wenn sie medizinisch notwendig ist.
Quelle: Huwiler V.V. et al. (2024) Thyroid; Laganà M. et al. (2025) Nutrients.
3) Helfen Selen und Myo‑Inositol bei Hashimoto?
Bei Patientinnen und Patienten mit Antikörpern und leichter Unterfunktion können Selen und Myo‑Inositol TSH und Antikörper verbessern. Das wurde in klinischen Studien gezeigt.
Quelle: Nordio M., Pajalich R. (2013) Journal of Thyroid Research; Nordio M., Basciani S. (2017) European Review for Medical and Pharmacological Sciences; Huwiler V.V. et al. (2024) Thyroid.
4) Was bringt Vitamin D?
Bei Vitamin‑D‑Mangel kann eine Gabe Antikörper senken und das Befinden bessern. Der Effekt auf Hormonwerte ist nicht in allen Studien gleich—am sinnvollsten ist die Behandlung eines nachgewiesenen Mangels über mehrere Wochen.
Quelle: Zhang J. et al. (2021) Journal of International Medical Research; Jiang H. et al. (2021) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.
5) Soll ich eine glutenfreie Ernährung ausprobieren?
Ohne Zöliakie ist der Nutzen uneinheitlich. Eine befristete Testphase mit guter Anleitung ist möglich; langfristig ist häufig die mediterrane Kost alltagstauglicher und gut belegt.
Quelle: Godhwani A. et al. (2023) American Family Physician – FPIN HDA; Ülker M.T. et al. (2023) Food Science & Nutrition.
6) Welche Ernährung ist empfehlenswert?
Die mediterrane Ernährung (viel Gemüse/Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Fisch, Olivenöl) wirkt entzündungshemmend und kann Antikörper, Blutfette und Lebensqualität verbessern. Sie passt gut zu einer medikamentösen Therapie.
Quelle: Laganà M. et al. (2025) Nutrients; Abushady M. et al. (2024) Endocrine Abstracts.
7) Haben Probiotika Einfluss auf die Schilddrüse?
Das Darmmikrobiom steht mit der Schilddrüse in Verbindung. Probiotika verbessern Hormonwerte nicht zuverlässig, können aber bei Autoimmunprozessen und Wohlbefinden unterstützend wirken—am wichtigsten bleibt eine darmfreundliche Ernährung.
Quelle: de Freitas Cayres L.C. et al. (2021) Frontiers in Immunology; Shu Q. et al. (2024) PLOS ONE.
8) Wie wirkt sich Stress aus—und was hilft?
Stress kann Autoimmunprozesse verstärken. Achtsamkeits‑ und Mitgefühlsübungen verbessern Stressresistenz und Lebensqualität und lassen sich gut in den Alltag integrieren.
Quelle: Morton M.L. et al. (2020) Mindfulness; Portokalidou Z. et al. (2022) Mindfulness.
9) Soll ich zusätzlich Jod einnehmen?
Zu viel Jod kann Autoimmunität anfeuern; zu wenig schadet ebenfalls. Am sinnvollsten ist eine bedarfsgerechte Zufuhr—keine Hochdosen ohne medizinische Begründung.
Quelle: Teti C. et al. (2021) Immunologic Research; Khudair A. et al. (2025) Frontiers in Endocrinology.
10) Was gilt bei Überfunktion (Morbus Basedow)?
Die Standardtherapie sind Hemmstoffe der Hormonbildung. Als Ergänzung können L‑Carnitin und Selen Symptome schneller lindern; das betrifft die Überfunktion, nicht Hashimoto.
Quelle: Rossi M. et al. (2025) Nutrients.
Hashimoto‑Thyreoiditis: Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, oft mit Unterfunktion.
Quelle: Teti C. et al. (2021).Subklinische Hypothyreose: Leichte Unterfunktion (TSH erhöht, FT4 normal), oft ohne starke Beschwerden.
Quelle: Nordio M., Basciani S. (2017).TSH / FT3 / FT4: Steuerhormon (TSH) aus der Hirnanhangsdrüse; FT3/FT4 sind aktive Schilddrüsenhormone.
Quelle: Standardendokrinologie‑Lehre, zusammengefasst in Huwiler V.V. et al. (2024).TPO‑Antikörper / Tg‑Antikörper: Abwehrstoffe gegen Schilddrüsen‑Enzyme/‑Eiweiße; typisch bei Hashimoto.
Quelle: Huwiler V.V. et al. (2024).TRAb: Antikörper gegen den TSH‑Rezeptor; typisch bei Morbus Basedow (Überfunktion).
Quelle: Rossi M. et al. (2025).Myo‑Inositol: Körpereigene Substanz, wirkt als Botenstoff; kann TSH‑Signalwege unterstützen.
Quelle: Nordio M., Pajalich R. (2013).Selen: Spurenelement für Schilddrüsen‑Schutzenzyme; kann Autoantikörper senken.
Quelle: Huwiler V.V. et al. (2024).Vitamin D: Hormonähnliches Vitamin, reguliert Immunsystem; bei Mangel substitutionieren.
Quelle: Zhang J. et al. (2021).Mediterrane Ernährung: Viel pflanzlich, Olivenöl, Fisch; entzündungshemmend.
Quelle: Laganà M. et al. (2025).Probiotika / Mikrobiom: „Gute“ Darmbakterien; Darmflora steht mit Immunität und Schilddrüse in Verbindung.
Quelle: de Freitas Cayres L.C. et al. (2021).Mindfulness / Achtsamkeit: Übungen zur Stressreduktion (Atmung, Aufmerksamkeit, Mitgefühl).
Quelle: Morton M.L. et al. (2020).Levothyroxin (LT4): Standardmedikament bei Unterfunktion; ersetzt fehlendes Hormon.
Quelle: Klinische Standardtherapie, kontextualisiert in Huwiler V.V. et al. (2024).
Autorin: Dr. med. Doris Gottfried | Letzte Aktualisierung: 07.11.2025

