Eisen im Körper: Funktionen, Symptome, Eisenaufnahme und Therapieformen im Überblick (Erlangen/Fürth/Nürnberg)
Eisen ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das für zahlreiche Funktionen im Körper verantwortlich ist – vom Sauerstofftransport über die Energiegewinnung bis hin zur Immunabwehr. Ein Eisenmangel bleibt oft lange unbemerkt, kann aber Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche oder Infektanfälligkeit verursachen. In diesem umfassenden Ratgeber erfahren Sie, wie Eisen im Körper aufgenommen wird, welche Faktoren die Eisenaufnahme beeinflussen, wie sich ein Mangel erkennen lässt und welche Therapieformen – von Tabletten bis zur Eiseninfusion – zur Verfügung stehen. Ideal für alle, die ihre Gesundheit aktiv unterstützen möchten.
Ihre Dr. med. Doris Gottfried (Privatpraxis für ganzheitliche und Orthomolekularen Medizin in Erlangen (Raum Nürnberg/Fürth)

Eisen im Körper: Funktionen, Bedeutung und Auswirkungen eines Mangels
Dieses Spurenelement ist für nahezu jede Körperzelle essenziell. Obwohl der Mensch nur etwa drei bis vier Gramm davon enthält, ist es für viele biologische Prozesse unverzichtbar. Ohne diesen Mikronährstoff könnten wir weder atmen noch Energie gewinnen, denken oder uns gegen Infektionen schützen.
Was ist Eisen?
Es handelt sich um einen Mineralstoff, den der Körper nicht selbst bilden kann – er muss über die Nahrung aufgenommen werden. Der Großteil befindet sich im Blut, gebunden an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin. Weitere Mengen sind in Muskeln (als Myoglobin), in Enzymen sowie in den Speichern von Leber, Milz und Knochenmark zu finden.
Die zentrale Rolle im Körper
Sauerstofftransport und -speicherung
Dieses Spurenelement ist entscheidend für den Sauerstofftransport. Es ist Bestandteil des Hämoglobins, das Sauerstoff in der Lunge aufnimmt und über das Blut verteilt. In den Muskeln speichert Myoglobin den Sauerstoff und stellt ihn bei Bedarf bereit – besonders bei körperlicher Belastung.
Energiegewinnung in den Zellen
In den Mitochondrien, den „Kraftwerken“ der Zellen, ist es Teil der Atmungskette. Dort wird Sauerstoff in Energie umgewandelt, die als ATP gespeichert wird. Ohne diesen Prozess wäre keine Energieproduktion möglich.
Zellteilung und DNA-Synthese
Der Mikronährstoff ist an der Bildung neuer Zellen beteiligt. Er wird für Enzyme benötigt, die die DNA-Synthese steuern – besonders wichtig in Wachstumsphasen, bei Wundheilung oder in der Schwangerschaft.
Hormonproduktion und Gehirnfunktion
Auch für die Bildung von Neurotransmittern wie Dopamin, Serotonin und Noradrenalin ist er notwendig. Diese Botenstoffe beeinflussen Stimmung, Konzentration, Schlaf und geistige Leistungsfähigkeit. Die Schilddrüse benötigt ihn ebenfalls zur Hormonproduktion.
Stoffwechsel und Entgiftung
Viele Enzyme im Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel enthalten diesen Stoff. Auch bei der Entgiftung – etwa beim Abbau von Medikamenten – spielt er eine Rolle und unterstützt die Leber.
Stärkung des Immunsystems
Er ist notwendig für die Bildung und Aktivierung von Immunzellen. Ein Mangel kann die Abwehrkräfte schwächen und die Anfälligkeit für Infekte erhöhen.
Kurzfristige Auswirkungen eines Eisenmangels
In der Anfangsphase bleibt ein Mangel oft unbemerkt, da die Symptome unspezifisch sind. Dennoch beeinträchtigt selbst ein leichter Mangel bereits wichtige Körperfunktionen.
Typische frühe Anzeichen sind Müdigkeit, Erschöpfung und Konzentrationsprobleme. Die Sauerstoffversorgung der Zellen ist eingeschränkt, was sich besonders im Gehirn und in der Muskulatur bemerkbar macht. Weitere Symptome können Blässe, Kurzatmigkeit bei Belastung, Kopfschmerzen, Schwindel und Kälteempfindlichkeit sein. Auch eine erhöhte Infektanfälligkeit kann auftreten, da das Immunsystem geschwächt wird.
Langfristige Auswirkungen eines unbehandelten Eisenmangels
Bleibt der Mangel über längere Zeit bestehen, kann sich eine Eisenmangelanämie entwickeln. Dabei sinkt der Hämoglobinwert im Blut, was zu einer chronischen Unterversorgung mit Sauerstoff führt.
Langfristig kann es zu körperlichen Veränderungen kommen, etwa zu brüchigen Nägeln, Haarausfall, eingerissenen Mundwinkeln oder Zungenbrennen. Auch Schlafstörungen und das sogenannte Restless-Legs-Syndrom sind möglich. Das Immunsystem wird weiter geschwächt, was die Anfälligkeit für Infekte erhöht. In schweren Fällen kann es zu Herz-Kreislauf-Belastungen kommen, da das Herz versucht, den Sauerstoffmangel durch erhöhte Leistung auszugleichen.
Psychisch kann ein chronischer Mangel zu Reizbarkeit, depressiven Verstimmungen, Ängstlichkeit und verminderter geistiger Leistungsfähigkeit führen. Gedächtnisprobleme und eine reduzierte Belastbarkeit im Alltag sind ebenfalls häufig.
Eisenwerte im Blut: Welche Laborwerte den Eisenstatus zuverlässig anzeigen
Wie wird der Eisenstatus im Blut gemessen?
Um festzustellen, ob ein Mangel oder Überschuss vorliegt, werden mehrere Laborwerte herangezogen – ein einzelner Parameter reicht dafür nicht aus:
Serumeisen (Eisen im Blutplasma)
Zeigt an, wie viel des Spurenelements aktuell im Blut zirkuliert.
Normwerte:
- Männer: 65–176 µg/dl
- Frauen: 50–170 µg/dl
- Kinder: altersabhängig, meist 50–120 µg/dl
Ferritin (Speicherwert)
Gibt Auskunft über die Reserven in Leber, Milz und Knochenmark.
Normwerte:
- Männer: 30–300 µg/l
- Frauen: 15–150 µg/l
- Werte unter 15 µg/l deuten auf leere Speicher hin.
Hinweis: Ferritin kann bei Entzündungen erhöht sein – auch bei gleichzeitigem Mangel.
Transferrin (Transportprotein)
Bindet das Spurenelement im Blut. Bei Unterversorgung steigt der Wert, da der Körper versucht, mehr davon zu transportieren.
Normwerte: 200–360 mg/dl
Transferrinsättigung (TSAT)
Zeigt, wie viel Prozent des Transportproteins tatsächlich beladen ist.
Normwerte: 20–50 %
Werte unter 20 % sprechen für eine Unterversorgung.
Hämoglobin (Hb)
Misst den Gehalt des roten Blutfarbstoffs, der das Spurenelement enthält.
Normwerte:
- Männer: 13–18 g/dl
- Frauen: 12–16 g/dl
- Schwangere: >11 g/dl
Ein niedriger Hb-Wert kann auf eine sogenannte Mangelanämie hinweisen.
Eisenaufnahme im Körper: So beeinflussen Ernährung, Darmgesundheit und Lebensmittel die Verwertung
Wie gelangt das Spurenelement in den Körper?
Die Aufnahme erfolgt hauptsächlich im Zwölffingerdarm (Duodenum) und im oberen Abschnitt des Dünndarms (Jejunum). Dabei unterscheidet man zwei Formen:
Hämeisen: In tierischen Lebensmitteln enthalten (z. B. Fleisch, Fisch), wird besonders gut verwertet.
Nicht-Hämeisen: Pflanzlicher Ursprung (z. B. Getreide, Hülsenfrüchte), wird schlechter aufgenommen.
Voraussetzungen für eine gute Verwertung
- Ausreichende Magensäure: Wandelt das Spurenelement in eine lösliche Form um.
Gesunde - Darmschleimhaut: Nur eine intakte Oberfläche kann es effizient aufnehmen.
Aktive - Transportproteine: Spezielle Eiweiße (z. B. DMT1) schleusen es durch die Darmwand.
- Hepcidin-Regulation: Dieses Hormon steuert die Aufnahme – bei Mangel wird sie erhöht, bei Überschuss gedrosselt.
Was fördert die Aufnahme?
Einige Nahrungsbestandteile verbessern die Verwertung – besonders bei pflanzlichen Quellen:
Vitamin C: Fördert die Umwandlung in eine besser aufnehmbare Form (z. B. in Paprika, Zitrusfrüchten, Brokkoli).
Fruchtsäuren: Zitronen- oder Milchsäure erhöhen die Löslichkeit.
Fleischfaktor: Eiweißbestandteile aus Fleisch oder Fisch verbessern auch die Aufnahme pflanzlicher Quellen, wenn beides kombiniert wird.
Was hemmt die Aufnahme?
Bestimmte Stoffe in Lebensmitteln können die Verwertung deutlich verringern:
Phytate: In Vollkorn, Kleie, Hülsenfrüchten
Oxalate: In Spinat, Rhabarber, Kakao
Tannine & Polyphenole: In schwarzem Tee, Kaffee, Rotwein
Calcium: In Milchprodukten
Phosphate: In Cola, Schmelzkäse, Fertigprodukten
Tipp: Diese Lebensmittel besser nicht direkt vor oder nach einer eisenreichen Mahlzeit konsumieren.
Lebensmittel mit hohem Gehalt (pro 100 g)
- Lebensmittel Gehalt (mg)
- Blutwurst 29,0
- Schweineleber 18,0
- Kürbiskerne 12,5
- Hirse 9,0
- Linsen (getrocknet) 8,0
- Bitterschokolade (70 %) 10,0
- Haferflocken 5,0
- Spinat (gekocht) 3,5
- Kichererbsen (gekocht) 2,9
- Rindfleisch 2,5
- Schwarze Johannisbeeren 1,3
Hinweis: Die tatsächliche Aufnahme hängt stark von der Kombination der Lebensmittel ab. Eine Mahlzeit mit Linsen und Paprika oder Haferflocken mit Orangensaft kann die Verwertung deutlich verbessern.
Normwerte:
- Männer: 13–18 g/dl
- Frauen: 12–16 g/dl
- Schwangere: >11 g/dl
Ein niedriger Hb-Wert kann auf eine sogenannte Mangelanämie hinweisen.
Warum viele Menschen Eisen schlecht aufnehmen – Ursachen, Risikogruppen und Folgen
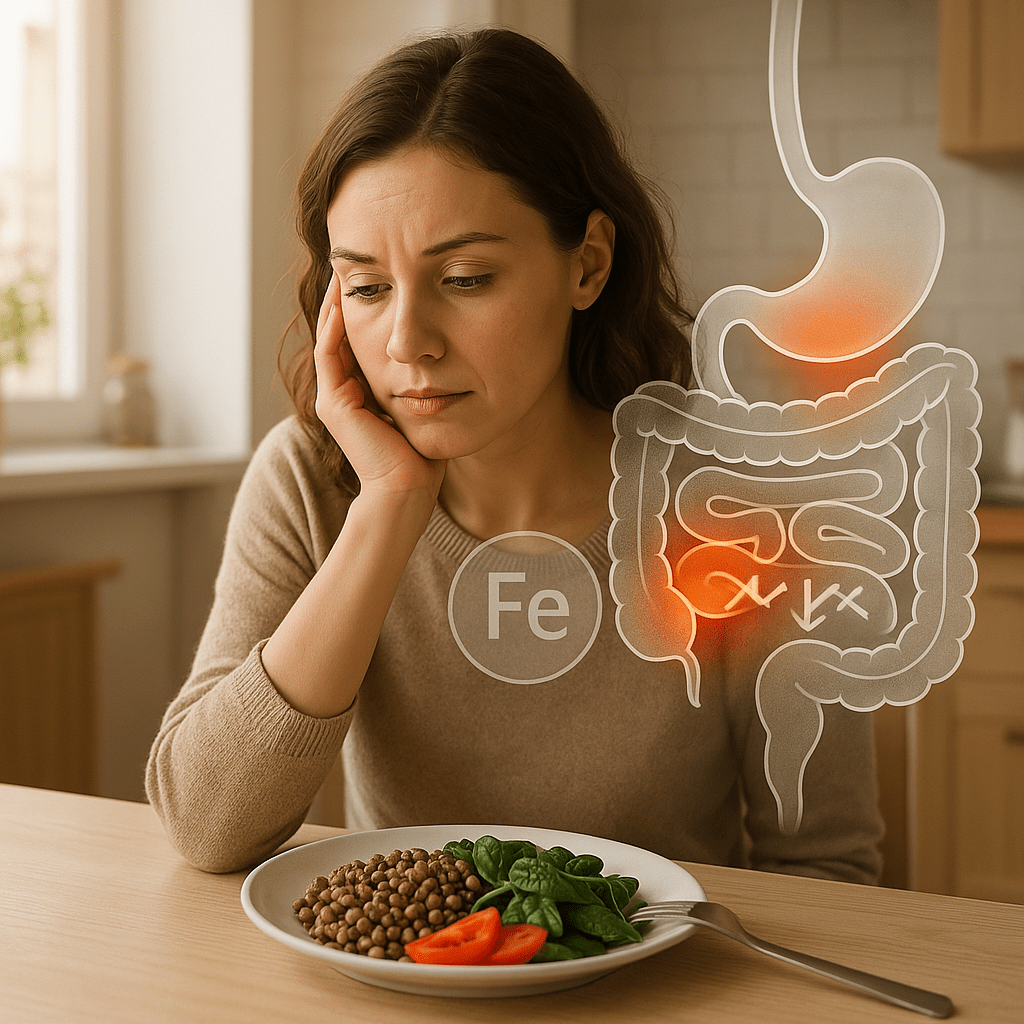
Obwohl das Mineral in zahlreichen Lebensmitteln enthalten ist, leiden viele Menschen an einem Mangel. Das liegt nicht nur an einer zu geringen Zufuhr, sondern häufig auch an einer gestörten Aufnahme im Darm. Die Ursachen sind vielfältig:
Geringe Bioverfügbarkeit pflanzlicher Quellen
Nicht-tierisches Eisen wird vom Körper deutlich schlechter verwertet als Hämeisen aus Fleisch oder Fisch. Zudem reagieren pflanzliche Formen empfindlich auf hemmende Stoffe in der Nahrung.
Reduzierte Magensäureproduktion
Eine ausreichende Säuremenge im Magen ist notwendig, um das Spurenelement in eine aufnehmbare Form zu überführen. Bei älteren Menschen, bei Einnahme von Säureblockern oder bei chronischer Gastritis ist die Produktion oft vermindert – die Verwertung sinkt.
Erhöhter Hepcidin-Spiegel
Das Hormon Hepcidin reguliert die Aufnahme im Darm. Es wird bei chronischen Entzündungen, Infektionen, Lebererkrankungen oder Übergewicht vermehrt gebildet und hemmt die Aufnahme.
Erkrankungen des Verdauungstrakts
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Zöliakie schädigen die Schleimhaut und verringern die Fähigkeit, Nährstoffe effizient aufzunehmen.
Vegetarische oder vegane Ernährung
Ohne tierische Quellen ist die Versorgung schwieriger. Pflanzliche Lebensmittel enthalten zudem oft Stoffe wie Phytate oder Oxalate, die die Resorption behindern.
Wie häufig ist ein Mangel?
Ein Defizit an diesem Spurenelement ist weltweit die häufigste Mangelerkrankung – auch in Industrieländern wie Deutschland. Besonders betroffen sind:
- Frauen im gebärfähigen Alter (durch Menstruation und fleischarme Ernährung)
- Schwangere und Stillende (erhöhter Bedarf)
- Kinder und Jugendliche im Wachstum
- Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Entzündungen
- Sportlich aktive Personen mit hohem Energieumsatz
In Deutschland erreichen viele Frauen zwischen 19 und 34 Jahren nicht die empfohlene Tageszufuhr. Studien zeigen, dass bis zu 50 % der menstruierenden Frauen unter einem Mangel leiden – oft unbemerkt, da die Symptome schleichend auftreten.
Eisenpräparate im Vergleich: Wirkstoffe, Verträglichkeit und Anwendung im Überblick
Übersicht: Häufig verwendete Wirkstoffe zur Substitution
Eisen(II)-sulfat (Ferrous Sulfate)
- Form: zweiwertig (Fe²⁺), meist als Tablette
- Bioverfügbarkeit: hoch
- Besonderheit: schnelle Freisetzung („Quick-Release“)
- Verträglichkeit: häufig Magen-Darm-Beschwerden
- Kosten: sehr günstig, oft unter 10 € pro Monat
- Geeignet für: kurzfristige Auffüllung bei unkompliziertem Mangel
Eisen(II)-bisglycinat (Chelat)
- Form: gebunden an die Aminosäure Glycin
Bioverfügbarkeit: sehr hoch - Besonderheit: magenfreundlich, gute
- Aufnahme auch bei empfindlichem Magen
- Verträglichkeit: sehr gut
- Kosten: mittel bis hoch (ca. 20–30 €)
- Geeignet für: langfristige Einnahme, sensible Personen
Eisen(III)-polymaltose-Komplex
- Form: dreiwertig (Fe³⁺) in Komplexbindung
- Bioverfügbarkeit: mittel
- Besonderheit: langsame Freisetzung („Slow-Release“)
- Verträglichkeit: sehr gut
- Kosten: ca. 15–25 € pro Monat
- Geeignet für: Kinder, ältere Menschen, chronische Anwendung
Eisen(II)-gluconat / fumarat / ascorbat
- Form: verschiedene zweiwertige Verbindungen
- Bioverfügbarkeit: gut
- Besonderheit: je nach
- Verbindung unterschiedliche
- Verträglichkeit: mittel
- Kosten: 10–20 € pro Monat
- Geeignet für: flexible
- Anwendung, Kombination mit Vitamin C empfohlen
Lactoferrin mit Eisen
- Form: natürliches Bindungsprotein, oft kombiniert mit Bisglycinat
- Bioverfügbarkeit: sehr hoch
- Besonderheit: unterstützt Immunsystem, physiologische Aufnahme
- Verträglichkeit: sehr gut
- Kosten: 25–40 € pro Monat
- Geeignet für: sanfte Auffüllung, Schwangerschaft, Stillzeit
Intravenöse Präparate (z. B. Ferinject, Monofer, Venofer)
- Form: Infusion unter ärztlicher Aufsicht
- Bioverfügbarkeit: 100 %
- Besonderheit: schnelle Speicherauffüllung, bypass des Darms
- Verträglichkeit: gut, aber mögliches Risiko für allergische Reaktionen
- Kosten: 100–300 € pro Infusion
- Geeignet für: schwere Mängel, Resorptionsstörungen, chronische Erkrankungen
Eine Infusion mit dem wichtigen Spurenelement kommt dann zum Einsatz, wenn eine orale Versorgung nicht ausreicht oder nicht vertragen wird. Dabei wird das Präparat direkt über die Vene verabreicht – meist in Form einer Infusion oder Injektion.
Wann ist eine Infusion sinnvoll?
Diese Therapieform eignet sich besonders bei:
- Unverträglichkeit von Tabletten oder Kapseln (z. B. bei Magen-Darm-Beschwerden)
Aufnahmestörungen im Verdauungstrakt (z. B. bei Morbus Crohn, Zöliakie) - Akutem Bedarf (z. B. bei starker Blutarmut, vor Operationen, in der Schwangerschaft)
- Chronischem Verlust oder erhöhtem Verbrauch (z. B. bei Dialyse, Herzinsuffizienz)
Ablauf der Behandlung
Die Verabreichung erfolgt ambulant in einer Praxis oder Klinik. Vorab wird der Status im Blut bestimmt. Je nach Präparat und Bedarf dauert die Infusion zwischen 15 Minuten und einer Stunde. Moderne Mittel ermöglichen auch hohe Dosierungen in nur einer Sitzung.
Gängige Präparate
- Ferinject® (Carboxymaltose): gut verträglich, bis zu 1000 mg pro Gabe
- Monofer® (Isomaltosid): hohe Einzeldosen möglich, auch bei
- Herzpatienten:
Venofer® (Hydroxid-Saccharose): bewährt, aber geringere Dosierungen pro Sitzung
Vorteile
- Schnelle Wirkung: Speicher werden innerhalb weniger Tage bis Wochen aufgefüllt
- Umgehung des Darms: ideal bei Resorptionsstörungen
- Gute Verträglichkeit: moderne Präparate benötigen keine Testdosis
Mögliche Nebenwirkungen
- Leichte Reaktionen wie Kopfschmerzen, Hautrötung oder metallischer Geschmack
- In seltenen Fällen allergische Reaktionen oder Kreislaufprobleme
- Ärztliche Überwachung während und nach der Gabe ist daher wichtig
- Kosten und Erstattung
Je nach Präparat und Dosis liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro. Bei medizinischer Notwendigkeit übernehmen gesetzliche und private Krankenkassen in der Regel die Behandlung – insbesondere bei nachgewiesenem Mangel und Unverträglichkeit oraler Mittel.
In meiner ärztlichen Praxis habe ich über viele Jahre hinweg sehr gute Erfahrungen mit der gezielten Substitution dieses essenziellen Mikronährstoffs gemacht – sowohl bei Patientinnen und Patienten mit chronischer Müdigkeit, Erschöpfung oder Infektanfälligkeit als auch bei nachgewiesenem Mangel, der sich schulmedizinisch nicht allein durch orale Präparate beheben ließ. Auch im präventiven Bereich, etwa bei Frauen mit starker Menstruation oder bei sportlich aktiven Menschen, hat sich eine individuell abgestimmte Versorgung bewährt.
Diagnostik: fundiert und individuell
Ein Mangel lässt sich zuverlässig durch eine Blutuntersuchung feststellen – insbesondere durch die Bestimmung von Ferritin, Transferrinsättigung und Hämoglobin. Zusätzlich nutze ich in meiner Praxis eine kinesiologische Testung, um individuell zu prüfen, ob ein funktioneller Bedarf besteht und welches Präparat vom Körper gut angenommen wird.
Qualität und Verträglichkeit im Fokus
Nicht jede Form der Substitution ist gleich gut verträglich. Viele meiner Patientinnen und Patienten berichten über Magenbeschwerden bei Tabletten oder Kapseln. Deshalb setze ich bevorzugt auf gut bioverfügbare und magenfreundliche Varianten – sei es oral oder intravenös. Die Qualität des Präparats und die individuelle Verträglichkeit stehen für mich im Mittelpunkt.
Wenn Sie sich für eine ganzheitliche, fundierte und individuell abgestimmte Versorgung mit diesem lebenswichtigen Spurenelement interessieren – sei es zur Prävention, zur Behandlung eines Mangels oder zur Unterstützung bei chronischer Erschöpfung – lade ich Sie herzlich ein, einen Termin in meiner Praxis zu vereinbaren. Gemeinsam finden wir heraus, welche Form der Unterstützung für Sie persönlich sinnvoll ist. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen!

Warum ist Eisen für den Körper wichtig?
Eisen ist essenziell für den Sauerstofftransport, die Energieproduktion und das Immunsystem.Welche Symptome deuten auf Eisenmangel hin?
Typische Anzeichen sind Müdigkeit, Blässe, Haarausfall, brüchige Nägel und Konzentrationsprobleme.Wie wird Eisen im Körper aufgenommen?
Eisen wird vor allem im Dünndarm resorbiert. Vitamin C verbessert die Aufnahme, während Kaffee und Milch sie hemmen.Welche Lebensmittel enthalten viel Eisen?
Rotes Fleisch, Leber, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte und grünes Blattgemüse sind gute Eisenquellen.Wie hoch ist der tägliche Eisenbedarf?
Frauen benötigen etwa 15 mg, Männer 10 mg pro Tag. In Schwangerschaft und Stillzeit ist der Bedarf erhöht.Welche Ursachen hat Eisenmangel?
Häufige Gründe sind Blutverlust, vegetarische/vegane Ernährung, chronische Erkrankungen oder Resorptionsstörungen.Wie wird Eisenmangel behandelt?
Je nach Schweregrad durch Ernährungsanpassung, orale Eisenpräparate oder Infusionen.Kann zu viel Eisen schädlich sein?
Ja, Eisenüberladung kann Organe schädigen. Eine Therapie sollte nur nach ärztlicher Diagnose erfolgen.
Ferritin
Speicherprotein für Eisen im Körper. Ein niedriger Ferritinwert deutet auf leere Eisenspeicher hin.
Hämoglobin
Eisenhaltiges Protein in den roten Blutkörperchen, das Sauerstoff transportiert.
Transferrin
Transportprotein für Eisen im Blut. Der Transferrinsättigungswert zeigt an, wie viel Eisen gebunden ist.
Hämatokrit
Anteil der roten Blutkörperchen am Gesamtblutvolumen. Sinkt bei Eisenmangel.
Resorption
Aufnahme von Eisen aus dem Darm ins Blut. Vitamin C verbessert die Resorption, Kaffee und Milch hemmen sie.
Hämochromatose
Erbkrankheit mit Eisenüberladung, die Organe schädigen kann.
Eiseninfusion
Therapieform bei starkem Eisenmangel oder Resorptionsstörungen, wenn Tabletten nicht ausreichen.
Erythrozyten
Rote Blutkörperchen, die Sauerstoff transportieren. Ihre Bildung hängt von Eisen ab.
Ferritinmangel
Frühstadium des Eisenmangels, bei dem die Speicher leer sind, aber Hämoglobin noch normal sein kann.
Anämie
Blutarmut durch Eisenmangel, erkennbar an niedrigem Hämoglobinwert.
Autorin: Dr. med. Doris Gottfried | Letzte Aktualisierung: 05.11.2025
